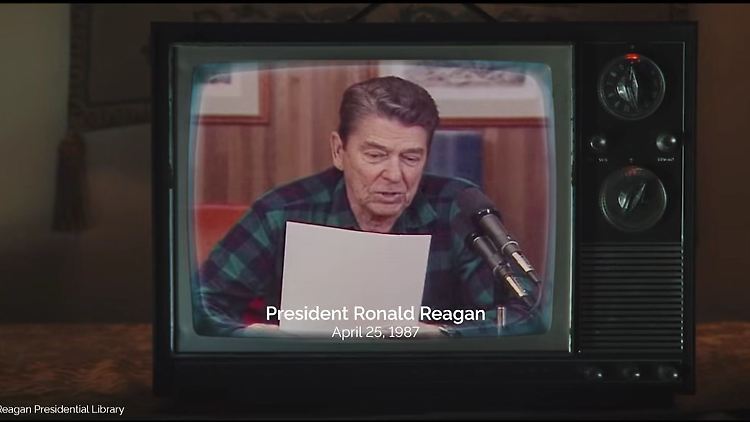In Deutschland unmöglich 10 Jahre Google
05.09.2008, 11:08 UhrVom Studentenprojekt zum Multi-Milliarden-Konzern mit fast 20.000 Mitarbeitern. Mit dieser Entwicklung haben die beiden Stanford-Studenten Larry Page und Sergej Brin wohl kaum gerechnet, als sie am 7. September 1998 ihre Firma Google Inc. gründeten. Allein in Deutschland werden derzeit vier von fünf Suchanfragen (79,8 Prozent) über Google gestellt, hat das Marktforschungsunternehmen ComScore ermittelt. Weltweit betrachtet steht Google mit einem Anteil von 60,4 Prozent ebenfalls auf dem ersten Platz, gefolgt von Yahoo (10,8 Prozent). An Marktanteilen gewonnen hat in den vergangenen Monaten insbesondere die chinesische Suchmaschine Baidu, die mit einem Anteil von 9,2 Prozent auf dem dritten Platz weltweit rangiert.
Mittlerweile umfasst das Produkt-Portfolio von Google zahlreiche Projekte wie den Bilderdienst Picasa, Google Mail, Google Maps oder den Web-Browser Chrome, den Google in diesen Tagen vorgestellt hat. "Die Kombination aus exzellenter Forschung und ausreichender Finanzierung war die optimale Keimzelle für Google", sagt Prof. August-Wilhelm Scheer vom Branchenverband BITKOM.
Datenkrake?
In jüngster Zeit hat der Ruf von Google allerdings sehr gelitten. Für Kritiker ist vom Motto "Don't be evil" nicht mehr viel übrig geblieben. Sie sehen in dem Internet-Giganten inzwischen eine Daten-Krake, die Infos über User und deren Verhalten hortet und gewinnbringend vermarktet. In den Datenschutzbestimmungen von Google steht: "Wenn Sie Google-Services nutzen, zeichnen unsere Server automatisch Daten auf, die Ihr Browser verschickt, wenn Sie eine Webseite besuchen. Diese Server-Logdateien können Ihre Webanfrage, die IP-Adresse, den Browsertyp, die Browsersprache, Datum und Uhrzeit Ihrer Anfrage und ein oder mehrere Cookies enthalten, die Ihren Browser eindeutig identifizieren können." Weil sich der Konzern weigert, klar anzugeben, was mit diesen gespeicherten Daten geschieht oder wie konkret sie geschützt werden, warnen Sicherheitsexperten vor dem "gläsernen User". Der Popularität von Google hat die Kraken-Diskussion allerdings nur wenig geschadet, wie die Statistik zeigt.
An der Elite-Universität Stanford haben Page und Brin an ihrer Idee gefeilt und im Rahmen des Studiums die Grundsteine für ihre Suchmaschine gelegt. Mit der Anschubfinanzierung von mehr als 1 Million Dollar stand schließlich 1998 genug Geld bereit, die Idee Wirklichkeit werden zu lassen. Scheer: "Von solchen Bedingungen können Studenten hierzulande nur träumen." Wie eine aktuelle BITKOM-Studie ergab, fehlten bei zwei von drei gescheiterten Gründungsplänen (64 Prozent) Kapitalgeber für das Start-up. "In Deutschland hat in den vergangenen Jahrzehnten allein SAP eine in etwa vergleichbare Erfolgsgeschichte geschrieben", sagt Scheer. Der Aufstieg von SAP in den Dax, den Index der 30 größten börsennotierten Unternehmen, liege allerdings auch schon 13 Jahre zurück. SAP ist die einzige deutsche Neugründung, die in den letzten Jahrzehnten den Aufstieg in den Leitindex geschafft hat. Der BITKOM fordert vor diesem Hintergrund, die Rahmenbedingungen für privates Beteiligungskapital zu verbessern. Vor allem steuerliche Anreize sind Scheer zufolge nötig, um Investitionen in Start-ups attraktiver zu machen. So können Verluste bisher nur sehr begrenzt bei der Steuer geltend gemacht werden.
Kritik an deutscher Politik
Der Google-Erfolg ist aber nicht zuletzt auch ein Resultat der amerikanischen Einwanderungspolitik. Ebenso wie Yahoo von Einwanderern gegründet wurde, ist der Erfolg von Google zumindest zur Hälfte einer gesteuerten Zuwanderung zu verdanken. Sergej Michajlovič Brin kam mit seinem Vater aus Moskau in die USA. Nach Deutschland zieht es hingegen kaum einen IT-Spezialisten. Insgesamt haben sich hier 2007 gerade einmal 466 hoch qualifizierte Arbeitnehmer aus Ländern außerhalb der EU niedergelassen. Weil aber die deutsche Gesellschaft auf solche positiven Impulse angewiesen ist, muss nach Ansicht des BITKOM das Zuwanderungsgesetz grundlegend reformiert werden. Wirksamstes Instrument ist ein Punktesystem. Danach darf einwandern, wer bestimmte Kriterien wie Qualifikation, Sprachkenntnisse oder Alter erfüllt. Von Jahr zu Jahr könnte die Politik entscheiden, wie viele Zuwanderer maximal kommen dürfen und welche Qualifikation sie haben müssen.
Daneben solle die Forschungs- und Wirtschaftspolitik stärker miteinander verzahnt und die ITK-Branche ins Zentrum gerückt werden, weil ihre Technologien Hebelwirkung für andere Sektoren haben. Langfristige Bedeutung hat die Reform des Bildungswesens – laut Scheer der Schlüssel zu vielen aktuellen Herausforderungen. Darüber hinaus solle durch eine Gründungs- und Wachstumsstrategie sichergestellt werden, dass gute Ideen aus der Forschung in erfolgreiche Produkte umgesetzt und junge Unternehmen schnell international aufgestellt werden. "Wir brauchen Exzellenz-Cluster, die international wettbewerbsfähig sind", sagt Scheer. Der Staat solle bei all dem eine Katalysatorrolle übernehmen, indem er im Rahmen öffentlicher Beschaffung gezielt technologische Innovationen anreizt.
Quelle: ntv.de