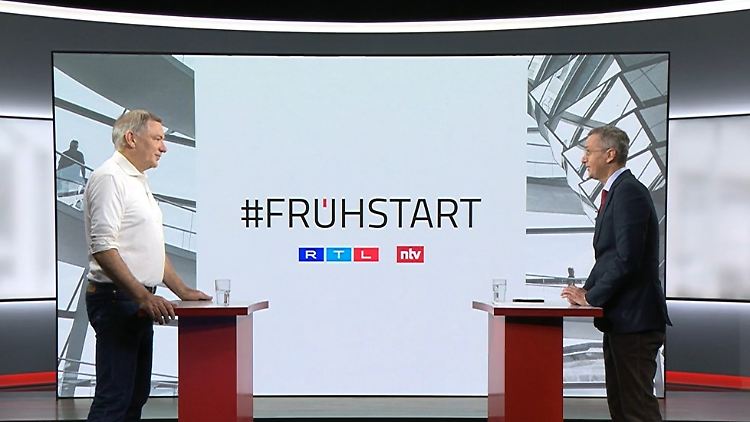16-Jähriger Hacker bleibt in Haft Assange kommt in Sonderzelle
10.12.2010, 22:20 Uhr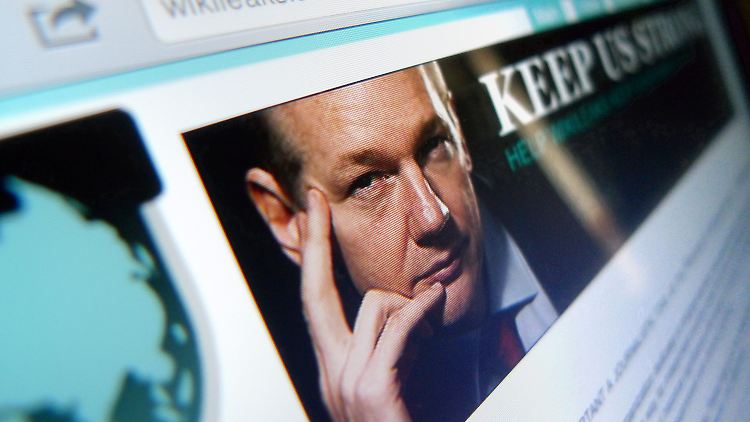
Assange erhielt sogar einen Computer.
(Foto: dpa)
Aus Sicherheitsgründen wird Wikileaks-Gründer Assange in eine Sonderzelle verlegt. Zudem erhält er einen Computer. Seine Anwältin fürchtet, er könnte in den USA nach einem Gesetz von 1917 angeklagt werden. Derweil bleibt ein 16-jähriger mutmaßlicher Hacker in Haft. Nach seiner Festnahme wird die Seite der niederländischen Staatsanwaltschaft angegriffen.
Der in Großbritannien verhaftete Gründer der Internet-Enthüllungsplattform Wikileaks, Julian Assange, ist in eine gesonderte Zelle eines Gefängnisses im Südwesten Londons verlegt worden. Die Gefängnisverwaltung habe die Verlegung "zu seiner Sicherheit" angeordnet, sagte Assanges Anwältin Jennifer Robinson. Die Anwältin sorgt sich inzwischen auch darum, dass der Wikileaks-Gründer in die USA ausgeliefert und dort nach einem Anti-Spionagegesetz aus dem ersten Weltkrieg angeklagt werden könnte.
Derweil bleibt ein 16-jähriger Niederländer, der an Internet-Attacken auf US-Finanzkonzerne beteiligt gewesen sein soll, bis auf weiteres in Untersuchungshaft. Die Ermittler dürfen ihn zunächst noch 13 Tage lang festhalten und vernehmen, entschied ein Richter in Rotterdam. Die Gruppe "Anonymous" verübte derweil weitere Angriffe auf Seiten im Internet.
Einen Computer gibt es auch
Der 39-jährige Assange habe in der Haftanstalt Probleme, weil er "keine Erholung bekommt, nur mit Schwierigkeiten nach draußen telefonieren kann und allein ist", sagte Anwältin Robinson weiter. Insgesamt sei er in "sehr guter Verfassung". Dem britischen "Guardian" zufolge soll dem Australier dort auch anders als bei Häftlingen sonst üblich ein Computer mit eingeschränkter Internet-Verbindung zur Verfügung stehen. Robinson sagte, Assange falle es schwer, mit der Hand zu schreiben, weshalb er zur Vorbereitung einer geplanten Justizbeschwerde einen Laptop brauche.
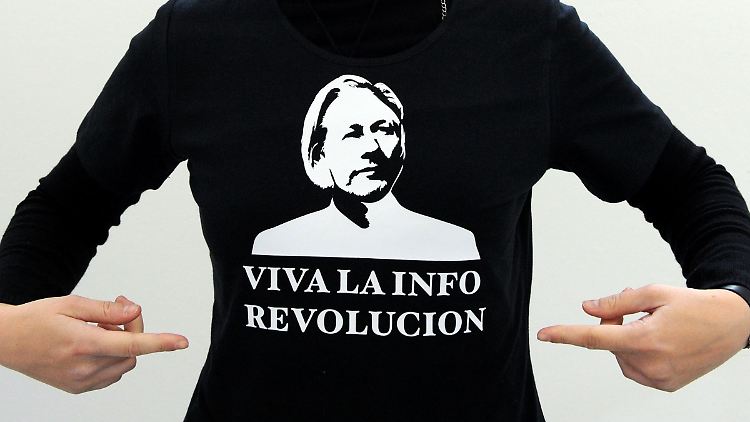
Es lebe die Informations-Revolution heißt es auf diesem T-Shirt mit dem Gesicht von Assange.
(Foto: dpa)
Assange hatte sich am vergangenen Dienstag in London der Polizei gestellt und war festgenommen worden, nachdem Schweden ihn per EU-weitem Haftbefehl gesucht hatte. Am kommenden Dienstag soll er erneut vor Gericht erscheinen. Es wird erwartet, dass er versuchen wird, auf Kaution freizukommen. Der Richter hatte seinen ersten Antrag auf Freilassung auf Kaution abgelehnt, weil er fürchtete, Assange könne flüchten. In Schweden werden ihm sexuelle Vergehen vorgeworfen. Der Australier weist die Anschuldigungen zurück und will gegen die Auslieferung nach Schweden kämpfen.
Robinson wandte sich zudem gegen Spekulationen, ihr Mandant solle an die USA ausgeliefert und dort nach dem Espionage Act aus dem Jahr 1917 angeklagt werden. "Das Gesetz trifft auf Mr. Assange nicht zu", sagte Robinson dem US-Sender ABCnews. Außerdem stehe der Wikileaks-Gründer unter dem Schutz des ersten Verfassungszusatzes der USA, in dem die Rede- und Meinungsfreiheit garantiert wird. "Jede Anklage nach dem Espionage Act verstößt gegen die Verfassung und würde alle Medien in den USA in Gefahr bringen", sagte Robinson.
Angriff auf Seite der Staatsanwaltschaft
Nach Einschätzung der niederländischen Staatsanwaltschaft ist der verhaftete 16-Jährige kein einfacher "Mitläufer". Bei ersten Vernehmungen habe er zugegeben, selbst Verantwortung für Internet-Angriffe auf Websites zu tragen. Die im Internet angegriffenen Finanzdienstleister, darunter Mastercard, Visa und PayPal, hatten im Zuge der Aufregungen um Veröffentlichungen von Wikileaks ihre Dienste für weitere Spenden an Wikileaks gesperrt. Die Attacken unter dem Namen "Operation Rache" werden von einer Gruppe mit dem Namen "Anonymous" organisiert.
Nach der Verhaftung des 16-Jährigen wurde auch die Internetseite der niederländischen Staatsanwaltschaft Opfer eines Hackerangriffs. Wie die Anklagebehörde mitteilte, war ihre Website "schwer erreichbar und während kurzer Zeit vollständig unerreichbar" gewesen. Eine anonyme Gruppe mit dem Benutzernamen "AnonTarget" bekannte sich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter zu dem Angriff auf die Seite. Wikileaks-Anhänger legten kurzzeitig auch die Homepage des Internet-Bezahldienstes Moneybookers lahm.
Wikileaks erklärte, sie habe nichts mit den Angriffen im Internet zu tun. Die Gruppe "Anonymous" habe keine Verbindungen zu Wikileaks, erklärte Sprecher Kristinn Hrafnsson. Auch Assange selbst wies jede Beteiligung an den Angriffen zurück. Er bedauerte in einer Stellungnahme, dass zurzeit vorsätzlich versucht werde, die Presseorganisation Wikileaks mit Hackern in Verbindung zu bringen.
Demonstration in Australien
Die Unterstützer von Wikileaks stellten sich allerdings auch mit Protestkundgebungen auf der Straße hinter die Enthüllungsplattform und ihren Chef Assange. In dessen Heimatland Australien demonstrierten hunderte Menschen gegen seine Inhaftierung. Mit Spruchbändern und Plakaten versammelten sich in mehreren Städten des Landes hunderte Wikileaks-Unterstützer und forderten die australische Regierung auf, sich für Assanges Rechte einzusetzen.
Wikileaks veröffentlicht seit Ende November Geheimdepeschen der US-Diplomatie im Internet. Neue Enthüllungen werfen unter anderem ein schlechtes Licht auf den Pharma-Riesen Pfizer und berichten von einer Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und dem Militärregime in Birma.
Bisherigen Informationen zufolge sollen die 250.000 vertraulichen Dokumente Wikileaks von einem 23-jährigen US-Gefreiten aus dem Irak zugespielt worden sein, der sie über das Pentagon-Netzwerk herunterladen konnte. Die US-Armee will nun mit verschärften Sicherheitsvorschriften mögliche neue Lecks verhindern. Wie das US- Magazin "Wired" berichtete, wurde allen Nutzern des internen Pentagon-Nachrichtennetzes der Gebrauch von externen Speichern untersagt. Darunter fallen nicht nur USB-Sticks und Festplatten, sondern auch MP3-Player wie ein iPod.
Daten "sehr schlecht geschützt"
Der durch die Wikileaks-Enthüllungen sichtbar gewordene sorglose Umgang der USA mit diplomatischen Informationen stößt bei deutschen Politikern auf Kritik. CDU/CSU-Fraktionschef Volker Kauder wirft der US-Regierung Schlampigkeit beim Datenschutz vor. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck von der SPD will nun weniger offen mit US-Diplomaten sprechen. Wenn ein Staat "so gigantische Datenmengen" sammele wie die USA, müsse er auch "gigantische Anstrengungen unternehmen, um diese Daten wirksam zu schützen", sagte Kauder der Potsdamer "Märkischen Allgemeinen Zeitung". Beck sagte dem "Hamburger Abendblatt", für die amerikanische Diplomatie sei mit der Veröffentlichung ein erheblicher Schaden entstanden. Die US-Regierung habe heikle Daten "sehr schlecht geschützt".
Die beiden Wikileaks-Dissidenten Daniel Domscheit-Berg und Herbert Snorrason gaben unterdessen weitere Einzelheiten zu ihrer Internetseite Openleaks bekannt, die demnächst als Konkurrenz zu Wikileaks starten soll. Openleaks werde anders als Wikileaks Informationen nicht direkt im Internet veröffentlichen, sondern solle Informanten erlauben, Informationen anonym an beteiligte Medien zu leiten, sagte Domscheit-Berg dem schwedischen Fernsehsender SVT.
Quelle: ntv.de, AFP/dpa/rts