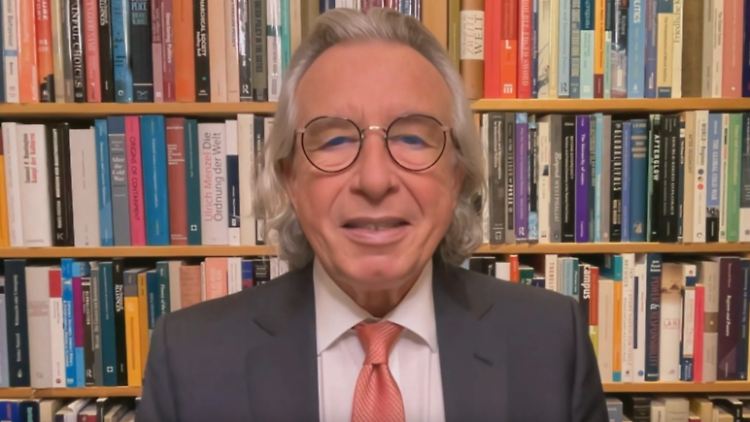Die Toten von Xinjiang und das große Schweigen Chinas unwürdiges Krisenmanagement
01.07.2013, 16:03 Uhr
Bewaffnete Paramilitärs in Xinjiang.
(Foto: REUTERS)
Es wird gemordet und gemetzelt in der chinesischen Provinz Xinjiang - und doch kräht kein Hahn danach. Obwohl deutsche Firmen in China investieren und Peking Berlin eine Traumpartnerschaft in Aussicht stellt, schweigen Politik und Wirtschaft zu den Vorfällen.
Man muss der chinesischen Regierung ein aufrichtiges Kompliment aussprechen. Sie hat es geschafft, dass kriegsähnliche Zustände mit 35 Todesopfern in der vergangenen Woche in ihrer nordwestlichen Provinz Xinjiang zu einer Randnotiz in den Medien verkümmerten. Zuallererst natürlich in den chinesischen Medien, denn die sind streng kontrolliert und müssen die Mär von ein paar verwirrten Terroristen im Heiligen Krieg verbreiten. Besonders aber auch in den internationalen Medien der demokratischen Welt. Diese Gewichtung ist unter anderem das Resultat gelungener Isolationspolitik einer gesamten Region im Ausnahmezustand, für die Peking mit massivem militärischem Aufwand sorgt, wenn es sein muss. Die Gleichung lautet: niemand rein plus niemand raus gleich keine Berichterstattung, selbst wenn gemordet und gemetzelt wurde. Pekings Taktik funktioniert: Nach 35 Toten in Xinjiang kräht kein Hahn mehr. Genauso wenig wie nach den 21 Toten in Xinjiang Ende April.
Den freien Medien kann man vorwerfen, dass sie sich einlullen und manipulieren lassen von der Propaganda aus der Volksrepublik, die immer betont, wie gut sich die Dinge in Xinjiang entwickeln. Gekoppelt an die strenge staatliche Kontrolle vergeht vielen Journalisten die Lust, das Thema erneut auf die Agenda zu setzen. Zumal im Juli vor vier Jahren fast 200 Menschen bei ethnischen Auseinandersetzungen in der Region starben. 21 Tote im April und jetzt 35 Tote sind deutlich kleinere Dimensionen. Aber die Schwerpunkte der Berichterstattung sind eben auch ein Spiegel der gesellschaftlichen Interessen, die von Medien intensiv studiert werden. Und hier liegt das eigentliche Problem. Nicht allein die Medien sind dafür verantwortlich, solche Konflikte auf die Tagesordnung zu setzen. Es sind die Politik und die Wirtschaft. Doch so sehr man lauscht: man hört fast nur Schweigen.
Seit dem Zwischenfall im Bezirk Turpan am Mittwoch letzter Woche, bei dem sich muslimische Uiguren und chinesische Polizisten wieder einmal gegenseitig abschlachteten, haben sich weder die Bundeskanzlerin noch der Außenminister zu dem Drama geäußert. Die Kanzlerin gratulierte zwei Tage später dem neuen Emir von Katar zu seiner Inthronisierung. Sie fand aber keine öffentlichen Worte an Chinas Premierminister Li Keqiang, der noch vor wenigen Wochen in Berlin die Traumpartnerschaft zwischen Deutschland und China beschwor. Außenminister Westerwelle, der sonst gerne ernste Miene zum bösen Spiel macht, fühlt sich auch nicht verantwortlich, wenn es um ein Mitglied des Weltsicherheitsrates geht.
Einzig der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Markus Löhning, forderte eine transparente Auflösung. Immerhin, aber das geht in der Öffentlichkeit völlig unter, weil Löhning keine Lobby besitzt, die seinen Aussagen Relevanz verschaffen. Wenn er sich zu Myanmar oder Mali äußert, mag das anders sein, weil die Adressaten ein paar Nummern unbedeutender sind als die Volksrepublik und Löhning dort tatsächlich als Repräsentanz der Bundesregierung wahrgenommen wird. Aber in China verpuffen seine Forderungen nach Transparenz. Wer ist Löhning, fragt man sich hier.
Wirtschaft hält sich bedeckt
Auch die Wirtschaft hält sich heraus. VW und BASF bauen Fabriken in Xinjiang, damit der Aufschwung der Volksrepublik auch den tiefen Westen erfasst. VW wurde geradezu genötigt, dort zu investieren. BASF tut es freiwillig. Aber weder hier noch dort kein Wort der Sorge, kein Wort der Anteilnahme. Nur Schweigen. Dabei ist China die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. 140 Milliarden Euro betrug das Volumen des deutschen Handels mit dem Land im vergangenen Jahr. China investiert Milliarden in Deutschland, große chinesische Firmen schaffen Tausende Arbeitsplätze zwischen Quickborn und Memmingen. Tausende deutsche Studenten bilden sich in China weiter und umgekehrt. Es leben Deutsche in Xinjiang. Aber nicht einmal der Asian-Pazifik-Ausschuss der deutschen Wirtschaft spricht über den Vorfall. Stattdessen ziehen alle den Kopf ein und hoffen, dass die Chinesen das schon hinbekommen mit der Harmonie, so wie es die autoritär regierende Kommunistische Partei ausgibt. Dass sie dazu die völlig falschen Mittel einsetzt, wird geflissentlich übersehen in Politik und Wirtschaft.
Es ist egal, ob die Toten das Resultat überraschender uigurischer Angriffe auf Polizeistationen waren, wie es die Chinesen darstellen, oder ob die Staatsmacht selbst Ausgangspunkt der neuen Eskalation war, wie es Exil-Uiguren behaupten. Fakt ist, dass es in China selbst keine aufrichtige Auseinandersetzung mit der Minderheitenpolitik der Partei geben darf. Peking argumentiert: Wir investieren dort, was wollen die noch? Dass sich Uiguren gleichwohl wie die Tibeter unterdrückt und benachteiligt fühlen, ist ein Tabuthema. Undank wirft man ihnen in China vor. Und jegliche Stimme, die sich unter Uiguren oder Tibetern erhebt, wird gnadenlos zum Schweigen gebracht. Mit allen Mitteln, meistens mit Gewalt, wie Exilanten sagen. Die Dutzenden Selbstverbrennungen von tibetischen Männer und Frauen in den vergangenen Jahren sind für manche die einzige und letzte Form des Protests gewesen. Zumal die einzige, die im Ausland noch wahrgenommen wird. Die Ausbrüche von Gewalt in Xinjiang sind nichts anderes. Auch dort fehlt den Menschen jegliches Ventil. Stattdessen greifen sie zu Waffen.
Chinas Krisenmanagement mag die Welt zum Schweigen bringen. Eines Traumpartners eines demokratischen Staates aber darf sie nicht würdig sein. Die Sprachlosigkeit in Deutschland und anderswo beweist einmal mehr, dass neben wirtschaftlichen Interessen kaum Platz für Würde bleibt.
Quelle: ntv.de