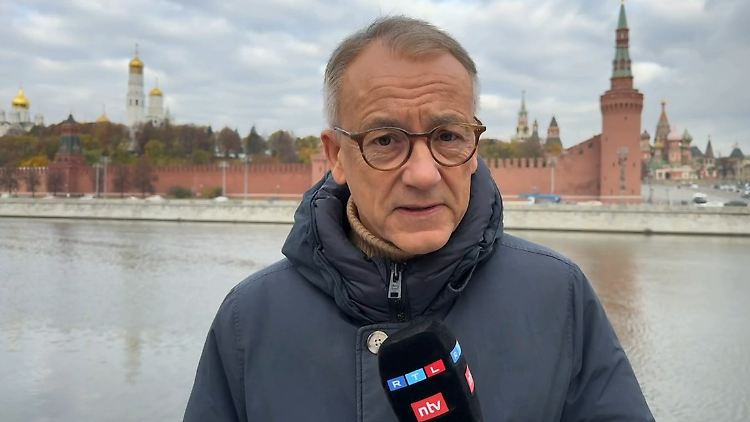Mammutstudie zur Familienpolitik Forscher loben Kitaausbau und Elterngeld
27.08.2014, 17:31 Uhr
Manuela Schwesig kann sich freuen: Die Gesamtevaluation der Familienleistungen kann als Bestätigung für ihre Politik interpretiert werden.
(Foto: dpa)
70 Wissenschaftler, vier Jahre, ein 400 Seiten starker Bericht: Familienministerin Schwesig präsentiert den umfangreichsten Bericht zur Familienpolitik, der je erstellt wurde. Zu ihrem Glück lassen sich die Ergebnisse ganz zu ihren Gunsten auslesen.
Ohne staatlich geförderte Kinderbetreuung wäre die Geburtenrate in Deutschland um zehn Prozent niedriger. Diese imposant erscheinende Zahl ist das letzte Ergebnis aus einer Mammutstudie zur Wirkung familienpolitischer Maßnahmen, die Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig in Berlin vorgestellt hat.
Die SPD-Politikerin deutete die Ergebnisse als Bestätigung für ihren Kurs eines "modernen Ansatzes" und stellte heraus: "Der Dreh- und Angelpunkt einer wirksamen Familienförderung ist die Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit." Dies verbessere die wirtschaftliche Situation der Familien und fördere damit auch das Wohlergehen der Kinder.
Mehr als vier Jahre lang haben rund 70 Wissenschaftler verschiedener Disziplinen an der sogenannten "Gesamtevaluation ehe- und familienbezogener Leistungen in Deutschland" gearbeitet. Entsprechend umfangreich ist der Bericht, der mehr als 400 Seiten umfasst. Teilergebnisse des von der früheren CDU-Familienministerin Kristina Schröder in Auftrag gegebenen Projekts waren bereits veröffentlicht worden.
Zwölf Einzelstudien sollten herausfinden, ob und wie die insgesamt mehr als 150 Einzelleistungen Familien oder potentielle Eltern beeinflussen. Dabei wurde der Status quo mit einem hypothetischen Fall verglichen, in dem es eine bestimmte Leistung - etwa Elterngeld - nicht gibt.
Ehegattensplitting fördert Ziele nicht
Für Kindergeld, staatlich geförderte Kinderbetreuung, Steuervorteile und direkte Geldleistungen gibt der Staat pro Jahr rund 153 Milliarden Euro aus. Eine Haupterkenntnis der Wissenschaftler überrascht daher nicht: Nicht alle dieser Maßnahmen seien gleichermaßen effektiv. Manche heben sich demnach sogar in ihrer Wirkung auf. Das Ehegattensplitting etwa fördere zwar kurzfristig das Familieneinkommen. Auf Dauer senke der Steuervorteil für Einverdienerehen aber die wirtschaftliche Stabilität von Familien, da meist die Ehefrauen langfristig auf volle Berufstätigkeit und Einkommen verzichten.
Wirtschaftliche Stabilität war als eines von vier politischen Zielen definiert worden, an denen die Leistungen in ihrer Wirksamkeit gemessen wurden. Weitere Ziele waren die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das Wohlergehen der Kinder sowie die Erfüllung von Kinderwünschen.
Die negativen Befunde werden dennoch vorerst keine Konsequenzen haben. Familienministerin Schwesig räumte ein, dass das Ehegattensplitting an 3,4 Millionen Familien vorbeigehe, weil die Eltern nicht verheiratet oder alleinerziehend seien. Sie betonte aber mit Verweis auf den Koalitionsvertrag, dass sie keine Ambitionen habe, eine Initiative gegen das Ehegattensplitting zu starten. "Es wird niemandem etwas weggenommen." Keine Wirkung in Hinblick auf die politischen Ziele hat auch die kostenfreie Mitversicherung für gering verdienende Ehepartner. Sie wolle sich in Zukunft aber vor allem auf den weiteren Ausbau der Kinderbetreuungsangebote und die Förderung von Alleinerziehenden sowie einkommensschwachen Familien konzentrieren.
126.000 Mütter arbeiten nur dank Kita
Der Befund, dass es ohne all diese Leistungen noch deutlich weniger Geburten gäbe, dürfte für die Ministerin besonders wertvoll sein, um ihre Politik gegen Kritiker zu verteidigen. Hieran wurde Familienpolitik in der Vergangenheit oft gemessen. Holger Bonin, Leiter des Forschungsbereiches Arbeitsmarkt am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, sagte allerdings: "Die Politik kann mit der Schaffung bestimmter Rahmenbedingungen nur begrenzt Einfluss auf die Geburtenrate nehmen." Ebenso entscheidend seien individuelle Einstellungen und Werte sowie die Lebenssituation von Männern und Frauen. Umso erstaunlicher der Befund aus der Teilstudie: Je mehr Kinderbetreuung angeboten wird, umso mehr Frauen bekommen überhaupt Kinder.
Elterngeld und Kindergeld dagegen befördern, dass Frauen nach einem ersten Kind noch zweite und teilweise dritte Kinder bekommen. Das liegt den Wissenschaftlern zufolge auch an der stärkeren Beteiligung der Väter, die im Elterngeldsystem gefördert wird.
Bonin nannte das Kindergeld als wichtigste staatliche Leistung für Familien. Hiervon profitieren besonders Familien mit geringen Einkommen. 1,2 Millionen Familien seien durch die Zahlung von Kindergeld nicht abhängig von Hartz IV. Schwesig betonte, die sogenannten "kleinen Leistungen" wie der Kinderzuschlag für Geringverdiener seien besonders effizient, kosteten aber vergleichsweise wenig.
Kindertagesbetreuung fördert den Ergebnissen zufolge das Haushaltseinkommen von Familien erheblich, weil sie beiden Eltern erlaubt, arbeiten zu gehen und Geld zu verdienen. Die Studie nennt die Zahl von 126.000 Müttern von Kindern zwischen einem und drei Jahren, die ohne Kinderbetreuung nicht erwerbstätig wären. Auch langfristig hätten Familien hierdurch stabilere Einkommen. Das Armutsrisiko von Familien mit Kindern unter zwölf Jahren sinkt der ZEW-Teilstudie zufolge um sieben Prozentpunkte. Hervorgehoben wird auch das Elterngeld, das im ersten Lebensjahr von Kindern das Armutsrisiko von deren Eltern um zehn Prozent senke.
Quelle: ntv.de, nsc