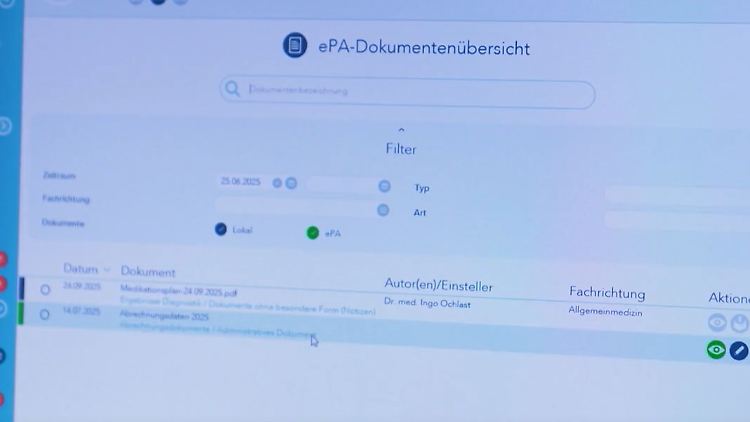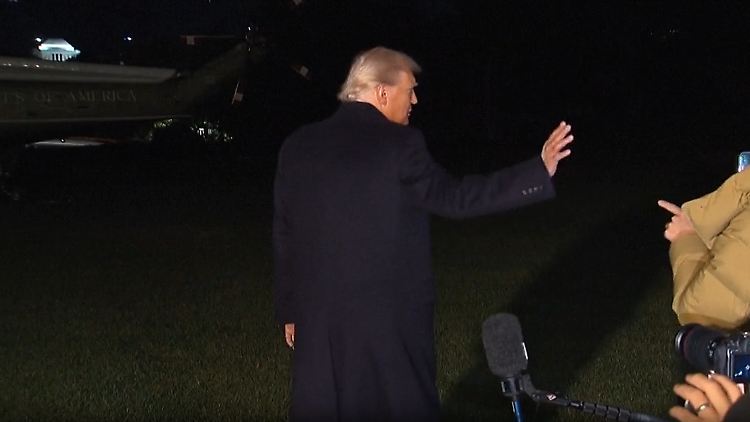Potosí und der Silberberg Südamerikas Für Alkohol, Koka und den "Onkel"
12.03.2012, 12:37 Uhr
Eines der "Tio"-Götzenbilder im Inneren des Berges.
(Foto: REUTERS)
Bolivien leidet noch immer unter den Folgen der spanischen Konquista. Im westlichen Hochland arbeiten die Bewohner Potoís seit Jahrhunderten in den Minen des "Silberbergs". Viele verlieren dabei ihr Leben, bislang schätzungsweise acht Millionen Menschen. Den Götzen der Spanier versuchen die "Mineros" mit purem Alkohol und Koka zu besänftigen.
"Das ist Tio", schallt Nacios Stimme durch das Halbdunkel. Rauch kräuselt sich in Richtung Stollendecke. Das Götzenbild, der "Onkel" ist noch immer der Schutzpatron in Potosí. Vor rund 450 Jahren begannen die Spanier hier die Ausbeutung des bolivianischen Gesteins - und der Menschen. "Seither sind etwa acht Millionen Ureinwohner in den Minen des Berges ums Leben gekommen", berichtet Nacio, ein professioneller Touristenführer.
"Die Völker Südamerikas sind arm, weil der Boden, auf dem sie leben, reich ist", schrieb der uruguayische Historiker Eduardo Galeano vor mehr als 40 Jahren. Der "cerro rico", der "reiche Hügel" in Potosí, barg viele Bodenschätze, vor allem Silber. Der Kegel ließ an seinem Fuß auf rund 5000 Metern über Normalnull eine Stadt heranwachsen, die auch heute noch am Tropf der Minerale hängt wie keine andere im Land. Nach der Entdeckung wurde der ganze Kontinent erfasst vom Silberrausch. Und davon geprägt.
Die Spanier schafften Kokablätter aus Peru heran, um die Ausdauer der Arbeiter zu erhöhen. Das Edelmetall wurde nach Buenos Aires verschifft. Es gab der Mündung zum Atlantik zwischen der argentinischen Hauptstadt und Montevideo ihren Namen: Rio de la Plata, der Silberfluss. In Castellano, dem Spanisch Südamerikas, nennen die Menschen ein leckeres Essen noch immer "rico".
Protzige Kirchen, arme Menschen
Heute hat der Berg für den Kontinent und die rund zehn Millionen Bolivianer kaum noch Bedeutung. Für die Stadt aber schon, der Tourismus lässt ihr Geld zufließen. Die Silbervorkommen sind weitgehend erschöpft, die Arbeiter brechen inzwischen deutlich weniger wertvolle Minerale aus dem Stein. Vom einstigen Reichtum sind nur die protzigen Kirchen geblieben. Potosí gehört zu den ärmeren Städten des Landes. "Hier gibt es für die Menschen keine Wahl, es gibt nur den Berg; keine Kultur, keine Industrie", sagt Carlos resignierend. Die achtstündige Schicht in den steinernen Gängen steht dem "Minero" noch bevor. Der 34-Jährige sieht jetzt schon müde aus.
Sein Schwager ging im Alter von 15 Jahren zum ersten Mal in den Stollen, fast 30 Jahre ist das her. Lange wird sein Körper nicht mehr mitmachen, er schleppt sich neben dem Jüngeren den Abhang hinunter. Seine Bewegungen wirken angestrengt, der Gang von der schweren Arbeit gebeugt, in die Nachmittagssonne blinzeln blutunterlaufene Augen. Das Weiß ist längst zu glasigem Gelb geworden. "Trink, trink!", bietet er das weiße Fläschchen an. Darin ist purer Alkohol, von dem er kurz noch ein wenig auf den rötlichen Boden tropfen lässt. Was die Erde und den "Onkel" der Minenarbeiter im bolivianischen Potosí besänftigt, das kann für die Männer im Inneren des Berges nicht schlecht sein. "Das Leben in Deutschland ist schön, oder?", fragt Carlos fast schüchtern: "Nicht wie hier. Hier ist es traurig."
Wie ein Termitenhügel
Auf dem Weg zum Stollen legt der Ältere immer wieder Pausen ein. In der einen Hand der Alkohol, in der anderen der Beutel mit Kokablättern. Als er keuchend rau auflacht, entblößt er viel Rot, sämtliche Oberzähne fehlen. Die verbliebenen unteren sind bräunlich.
Nacio dagegen hatte Glück im Unglück. Nach zwei Arbeitsunfällen in jungen Jahren finanzierte eine französische Initiative dem inzwischen 24-Jährigen ein Tourismusstudium. Nun rüstet er Besucher mit Helmen aus, kriecht mit ihnen in den Hügel, erzählt dessen Geschichte. Und manchmal auch seine eigene. Heute noch arbeiten etwa 14.000 Menschen in und vor den Minen, Maschinen gibt es wenige. Manche sind in Privatunternehmen beschäftigt, andere organisiert in Kollektiven aus Familien, die sich die Schichten in den Bergwerken untereinander aufteilen. Manche leben zusammengepfercht neben den Eingängen in notdürftigen Hütten auf wenigen Quadratmetern. "Im Schnitt verdient ein Arbeiter etwa viereinhalb Bolivianos pro Schicht", so Nacio, umgerechnet etwa 60 Cent. Etwa 350 Mal bringt er dafür per Schubkarre Gestein aus dem Innern nach draußen, wo andere es bearbeiten.

Auch Anfang 2011 brachen plötzlich Hohlräume in sich zusammen - ein 18 Meter tiefer Krater bildete sich.
(Foto: REUTERS)
Nach Jahrhunderten der Ausbeutung gleicht der Berg einem Termitenhügel. Löcher, Stollen, notdürftig abgestützt mit feuchtem, morschem Holz, auf dem brüchiges Gestein lastet. Wenn es regnet, stürzen Gänge manchmal einfach ein, erzählt Carlos. Wer Pech hat, wird von den Geröllmassen begraben. Die Zahl der Unfälle drückt die durchschnittliche Arbeitsdauer der Beschäftigten auf rund 20 Jahre. Ohne diese Gefahr wären es ebenfalls nur 30 Jahre. Länger machen die Lungen nicht mit; "der Staub", sagt Nacio.
Tradition und Anklage
Stoisch und mit starrem Blick beobachtet das Bildnis des "Onkels" all dies seit Jahrhunderten. Blaue Augen hat es, einen Bart wie der eines Konquistadors; zudem hellhäutig, muskulös, mit Teufelshörnern versehen. Es ist eine einschüchternde Kreation der damals herrschenden Spanier. Noch immer stecken ihm die Bergarbeiter Zigaretten in den Mund, legen ihm Kokablätter oder puren Alkohol zu Füßen. Das besänftigt den Götzen. Vor hunderten Jahren war das einfacher, als Zehntausende Ureinwohner zur Beichte in die Kirche zu schicken. Inzwischen ist es Tradition und Anklage zugleich. Die Arme des Tio sind rot vom Blut, mit dem die Arbeiter ihn beschmiert haben.
Inzwischen regiert in Bolivien Evo Morales, der erste Präsident indigener Abstammung in Südamerika. Seit dessen Amtsantritt im Januar 2006 hat sich vor allem in der Eigendarstellung des Staates einiges getan. Polizisten tragen neben der international anerkannten Flagge samt Silberberg auch die der Ureinwohner, auf Münzen steht nun "Multiethnische Republik" und "Die Einheit ist die Stärke".
Macht der Folklore
"Die einheitliche Sprache, die moralischen Werte", das seien die positiven Aspekte der Konquista, sagt Tomas, Geschichtslehrer für 13- bis 15-Jährige in einer weiterführenden Schule. "Ich unterrichte wertungsfrei", betont er. Er schwärmt wie andere Bolivianer lieber von der Eigenständigkeit der Republik und den "guten Menschen", die trotzdem durch die Anziehungskraft der Städte in die urbane Armut schlitterten.
Potosí ist nicht die einzige Region Boliviens, die mit schlechten Lebensbedingungen kämpft. Im Osten und Südosten des Landes, den als wohlhabend geltenden Gegenden, ist die Armut ebenfalls allgegenwärtig.
Auch dort tragen die Frauen der indigenen Völker traditionell die schwarzen Haare zu zwei geflochtenen Zöpfen. So wollten es die Spanier vor hunderten Jahren, so ist es geblieben. Es ist wie der "Tio" in den Minen des Silberbergs - ein weiteres Überbleibsel der Konquista, übergegangen in die Folklore des Landes.
Quelle: ntv.de