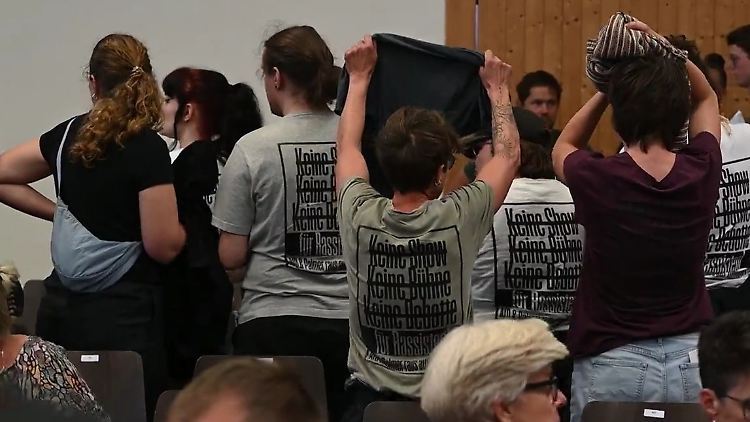Mehr Frauen in Aufsichtsräte Was sich heutzutage so alles "Quote" nennt
06.03.2015, 12:06 Uhr
(Foto: picture alliance / dpa)
Der Staat mischt sich in die Entscheidungen von Unternehmen ein, um Frauen zu fördern. Hoffentlich ist das erst der Anfang.
Aktionäre bestimmen nun nicht mehr allein, wer in den Aufsichtsräten ihrer Unternehmen sitzen darf. Ab heute redet der Staat ihnen kräftig rein. Wenn Plätze frei werden, müssen die Aktionäre so lange Frauen berufen, bis eine Quote von mindestens 30 Prozent erreicht ist.
Mischt sich die Politik zu sehr ein? Pfuscht sie privaten Unternehmen in ihr Handwerk? Es gibt für den Staat gute Gründe, sich aus der Wirtschaft herauszuhalten und die Firmen einfach machen zu lassen. Es gilt die Faustformel: Je freier private Investoren sind, desto eher kommen sie auf neue Geschäftsideen und schaffen neue Arbeitsplätze.
Doch die Frauenquote für Aufsichtsräte korrigiert eine Situation, die auf ein Versagen der Marktmechanismen zurückzuführen ist. Und sie ist das sanfteste Mittel, das man sich zur Beseitigung dieses Versagens vorstellen kann.
Kein böser Wille, aber ein Problem
Das Marktversagen besteht darin, Frauen nicht genügend Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt werden, die ihrer Qualifikation angemessen sind. Auf einem perfekt funktionierenden Arbeitsmarkt würden Männer und Frauen mit gleicher Qualifikation gleichwertige Jobs machen und gleich bezahlt werden. Doch so ist es nicht. Frauen kommen schlechter in die gut bezahlten Positionen und verdienen selbst dann noch weniger als ihre männlichen Kollegen, wenn sie den gleichen Job machen.
Was mag die Ursache dafür sein? Zum Teil lassen sich die Unterschiede wohl damit erklären, dass Frauen die Karriere weniger wichtig ist und sie öfter Pausen zur Kindererziehung einlegen. Darüber hinaus stoßen Frauen in ihrer Berufslaufbahn aber offensichtlich auch oft auf Chefs, die systematisch weibliche Bewerber benachteiligen. Das muss im Einzelfall kein böser Wille sein. Männer stellen halt lieber Männer ein. Aber in der Masse wird es zu einem Problem.
Zur Lösung dieses Problems gäbe es nun verschiedene Mittel. Wollte man es sich einfach machen, könnte man den Chefs vorschreiben, einen bestimmten Anteil an Frauen einzustellen. Das Wort "Frauenquote" deutet darauf hin, dass genau das jetzt passiert. Doch so ist es nicht. Denn die Quote bezieht sich nicht auf das Management eines Unternehmens, auf die Vorstände und Führungsetagen etwa, sondern nur auf den Aufsichtsrat. Ein Platz in einem Aufsichtsrat ist aber kein Vollzeitjob, sondern lässt sich in der Regel mit einigen Tagen Arbeit im Jahr bewältigen.
Was, wenn die Quote nicht wirkt?
Die nun beschlossene Frauenquote greift also nicht in das Herz der Unternehmen, sondern betrifft nur eine Kontrollinstanz. Sie betrifft außerdem nur rund 100 große Unternehmen und ist mit 30 Prozent sehr niedrig angesetzt. Hinter dem Wort "Frauenquote" könnte man noch wesentlich massivere Eingriffe in privatwirtschaftliche Entscheidungen vermuten. Dazu ist der Bundestag, insbesondere die Union, bislang aber nicht bereit.
Trotzdem könnte das neue Gesetz etwas bewirken. Durch mehr Frauen in den Räten könnten die männlichen Seilschaften aufgebrochen werden, könnten sich Unternehmenskulturen verändern. Die Chancen von Frauen, in Führungspositionen vorzudringen, könnten dadurch steigen, ohne dass der Staat entsprechende Vorschriften macht.
Die Frauenquote für Aufsichtsräte ist darum ein lohnenswerter Versuch, das Versagen des Marktes zu korrigieren. Die Unternehmen haben nun etwas Zeit, ihre Kultur zu ändern. Dabei muss klar sein: Wenn die Aufsichtsrats-Quote nicht wirkt, müssen stärkere Mittel her.
Quelle: ntv.de