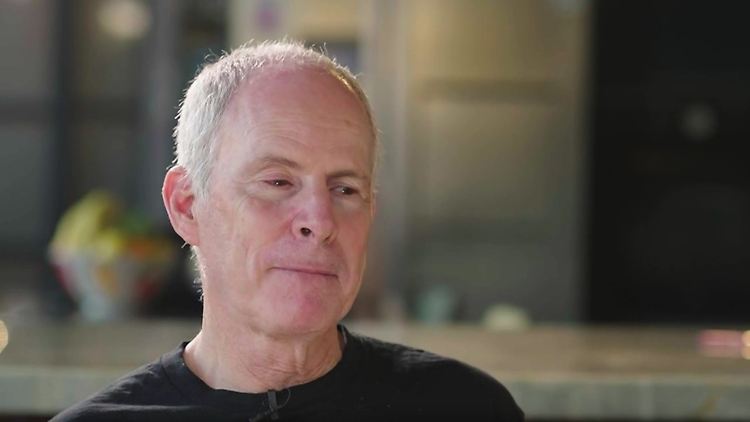Geschäfte ja, neue Politik nein Al-Maliki in Berlin
20.07.2008, 10:35 UhrBei den Gesprächen, die Iraks Ministerpräsident Nuri al-Maliki am 22. Juli in Berlin führen will, geht es vor allem um Geschäfte. Eine enge politische Zusammenarbeit ist nicht in Sicht - auch wenn dies Bagdad gern so hätte. "Wir stehen in Verhandlungen mit Siemens, Daimler und deutschen Firmen aus den Bereichen Landwirtschaft, Öl und Gas", erklärt Regierungssprecher Ali al-Dabbagh. Als Zeichen für einen Paradigmenwechsel im irakisch-deutschen Verhältnis will er den Al-Maliki-Besuch aber nicht werten. Denn dieses Verhältnis ist in den fünf Jahren seit dem Sturz Saddam Husseins durch die US-Armee nie ganz spannungsfrei gewesen.
Das liegt einerseits daran, dass fast alle Mitglieder der irakischen Nachkriegsregierungen ehemalige Oppositionelle sind, die Saddam hassten und deshalb wenig Verständnis für das Nein der Bundesregierung zur Irak-Invasion aufbringen konnten. Außerdem lässt sich die Herangehensweise der deutschen Außenpolitik an das Irak-Thema unter Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) und seinem Vorgänger Joschka Fischer (Grüne) als "wohlwollend, kritisch und voller Sorge" beschreiben. Die Führung in Bagdad forderte aber stets blindes Vertrauen, Optimismus und aktive Solidarität.
Da tut es weh, wenn das Auswärtige Amt Deutschen rät, den Irak zu verlassen und in seiner Reisewarnung erklärt, die irakischen Sicherheitskräfte seien wohl nur eingeschränkt einsatzfähig und wegen "unklarer Loyalitäten" zum Teil nicht fähig oder bereit, Ausländer zu schützen.
Dass diese Einschätzung immer noch als realistisch gelten muss, bewies Bundeswirtschaftsminister Michael Glos (CSU), der vor einigen Tagen als erster deutscher Minister seit 1987 im Irak war. Nach der Fahrt vom Flughafen, während der er kugelsichere Weste und Stahlhelm trug, besuchte Glos das Botschafts- und Regierungsviertel in der streng abgeriegelten "Grüne Zone". Die deutsche Botschaft, die nicht in der von amerikanischen und irakischen Soldaten bewachten Zone liegt, bekam er nicht zu Gesicht. Zu groß war das Risiko.
Je größer das Geschäft, desto sicherer
Dieses Risiko gegen Profite abzuwägen, die deutsche Firmen im Irak machen könnten, ist nicht immer leicht. Für Mittelständler ist der Sicherheitsaufwand, den betreiben muss, wer Fachkräfte in den Irak schicken will, wohl zu groß. Der Fall der beiden Techniker aus Leipzig, die von Januar bis Mai 2006 im Irak in Geiselhaft waren, ist noch nicht vergessen. Doch je größer der Konzern und je größer das Projekt, desto eher fällt die Risiko-Gewinn-Abschätzung positiv aus.
Außerdem ist die Angst spürbar, vielleicht zu lange zu zögern und damit der Konkurrenz aus anderen Industrienationen das Feld zu überlassen. So verhandelt der Irak nach Aussage von Al-Dabbagh derzeit sowohl mit Siemens als auch mit dem US-Konkurrenten General Electric über Großaufträge im Bereich Stromversorgung. Bislang sind deutsche Firmen nur im kurdischen Autonomiegebiet im Norden wirklich aktiv, wo es viel sicherer ist als in anderen Landesteilen und wo man fast nie US-Soldaten trifft.
Busfabrik im "Todesdreieck"
Beides gilt nicht für Iskanderija, eine Kleinstadt, die südlich von Bagdad liegt, in einer Region, die wegen der vielen Terroranschläge lange Zeit nur das "Todesdreieck" genannt wurde. Hier steht eine staatliche Busfabrik mit alten Maschinen und Werkzeugen mit heute nur noch rund 450 Beschäftigten. In der Saddam-Ära standen hier fast 3500 Menschen in Lohn und Brot. Mit Daimler verhandeln die Iraker jetzt darüber, ob hier demnächst Busse und Lastwagen deutscher Bauart vom Band laufen sollen.
Al-Maliki, der einer islamischen Schiiten-Partei angehört, ist nicht der erste irakische Regierungschef der Nach-Saddam-Ära, der Berlin besucht. Vor ihm war schon einer seiner Widersacher, der säkulare Schiit Ijad Allawi, eingeladen worden. Drei Iraker, die der Terrorgruppe Ansar al-Islam angehören, hatten während des Allawi-Besuches im Dezember 2004 ein Attentat auf den Regierungschef geplant. Deshalb wurden sie gerade erst in Stuttgart zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.
Quelle: ntv.de, Anne-Beatrice Clasmann, dpa