Von wegen "Booster" Typische Retro-Idee der Neoliberalen
17.04.2021, 09:23 Uhr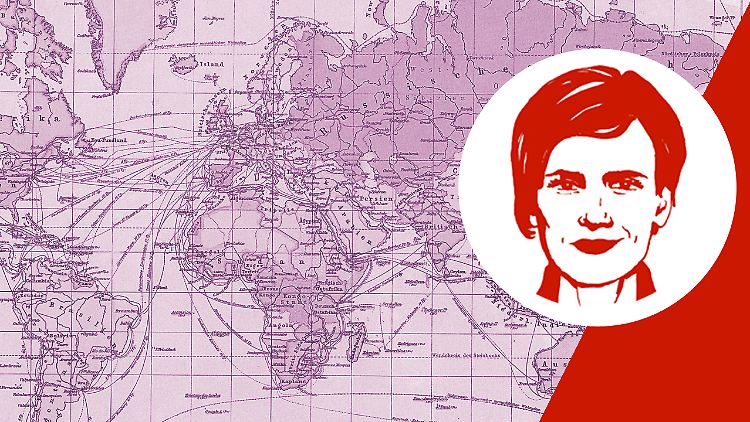
"Segensreich" war der Freihandel des 19. Jahrhunderts nur für die Kolonialmächte, schreibt Katja Kipping.
Das Muster ist bekannt: Es gibt eine Krise - und was machen die Liberalen? Sie rufen nach Freihandel. Die eigentliche Frage ist jedoch, wie wir ein nachhaltiges Wirtschaften einleiten, das den Herausforderungen der Zeit gerecht wird.
Der Freihandel, wie ihn Neoliberale sich vorstellen, ist eine Retro-Idee, die nicht mehr in die Zeit passt. Seine Bilanz ist schlecht. Einer der bekanntesten Freihandels-Theoretiker, David Ricardo, verband mit Freihandel die Hoffnung, dass dann "natürlicherweise jedes Land sein Kapital und seine Arbeit solchen Verwendungen widmet, die jedem am segensreichsten sind". Ricardo lebte in der Zeit des Kolonialismus: Starke Volkswirtschaften beuteten ihre Kolonien aus und verschifften deren Ressourcen über die Weltmeere. Die Kostenvorteile, die Ricardo sich erhoffte, stellten sich nur für die Kolonialmächte ein.
Die Welt teilte sich ein in wenige reiche Industrienationen und den globalen Süden, der ausgebeutet wurde. Damit wollte man in den 1970er-Jahren Schluss machen. Die Vereinten Nationen richteten unter Führung des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt eine eigene Kommission ein, die Vorschläge erarbeitete, um die Weltwirtschaft gerechter zu gestalten. Die Generalversammlung verabschiedete eine Resolution über eine "neue Weltwirtschaftsordnung" (New Economic International Order): Die neue Ordnung sollte weltweit für Ausgleich und Nachhaltigkeit sorgen.
Doch dann setzten die Neoliberalen das Gegenteil durch: In der Welthandelsorganisation WTO und im europäischen Binnenmarkt wurde in den 1990er-Jahren eine neoliberale Freihandels-Agenda verankert. Die Idee lautete: möglichst viel Abbau von Zöllen und Regulierungsmöglichkeiten, Gleichbehandlung aller Investor*innen unabhängig davon, ob sie die Umwelt zerstören oder soziale Schutzstandards mit Füßen treten. Bis heute hängen Liberale dieser Idee an. Auch Konstantin Kuhle argumentierte vor einer Woche in dieser Kolumne so. Er sieht im Freihandel einen "Booster gegen den Corona-Blues".
Die Folgen dieses Denkens sehen wir heute: eine vertiefte soziale Ungleichheit, die Unfähigkeit, auf den Klimawandels zu antworten sowie die Aufgabe demokratischer Gestaltungsmacht und ein Vertrauensverlust in die Globalisierung. Dies schafft einen Nährboden, den vor allem Nationalist*innen in den letzten Jahren für sich zu nutzen wussten.
Mittlerweile ist diese Einsicht selbst im Rat der Wirtschaftsweisen unseres Landes angekommen. So spricht sich etwa Ratsmitglied Achim Truger dafür aus, die politische Ökonomie der Handelspolitik aus ihrer ideologischen Einseitigkeit zu befreien und stärker in den Fokus zu nehmen, was unter welchen Bedingungen von wem wo produziert wird, und welche ökonomischen und sozialen Auswirkungen dies hat.
Fluchtursache Freihandel und ökologische Kosten
Er hat recht, denn die Retro-Ideen der Liberalen schaffen täglich Fluchtursachen. Der Tomatenbauer aus Ghana kann seine Tomaten kaum noch verkaufen, weil die mit EU-Subventionen und einer hochindustrialisierten Landwirtschaft preiswert produzierten Dosentomaten aus Europa auch in seiner Region billiger sind. Die wirtschaftliche Not zwingt viele afrikanischen Landwirte dazu, die Flucht nach Europa zu riskieren.
Sicherlich, es gibt Bodenschätze, die nur an einigen Orten anzufinden sind. Es gibt landwirtschaftliche Produkte wie Kaffee, die nur unter bestimmten Bedingungen gedeihen und die weltweit gehandelt werden müssen. Doch darüber hinaus hat die Menge an Gütern, die täglich rund um den Globus transportiert wird, ein Ausmaß angenommen, das auch ökologisch verheerende Folgen hat. Schließlich geht ein Viertel aller schädlichen Emissionen auf das Konto der globalen Warenströme. Insofern können wir festhalten, dass heute vom Freihandel noch nicht einmal die Menschen in den westlichen Ländern profitieren, denn allein die ökologischen Folgekosten sind für uns alle zu hoch. Freihandel ist also kein Booster. Er ist vielmehr ein Downer, also ein Ansatz, der alle nach unten zieht.
Motoren des Wandels stärken
Was es jetzt braucht, ist keine Retro-Freihandels-Agenda, sondern verstärkte internationale Zusammenarbeit für nachhaltiges Wirtschaften. Schon aus Klimaschutz-Gründen kann das Entwicklungsmodell nicht darin bestehen, unter Bedingungen globaler Dumping-Konkurrenz Güter um den Globus zu transportieren, die auch regional hergestellt werden könnten. Im Gegenteil, wir brauchen eine Stärkung der regionalen Wirtschaftskreisläufe sowie verbindliche soziale und ökologische Regeln. Das ist auch im Interesse jener Unternehmen, die schon dabei sind, sich auf die Herausforderungen der Zukunft einzustellen. Diese Motoren des notwendigen wirtschaftlichen Wandels müssen geschützt und gestärkt werden.
Wir sollten mit dem europäischen Binnenmarkt beginnen und einen neuen Anlauf wagen. Statt Privatisierung und Wettbewerb müssen wir den europäischen Markt mit einem ambitionierten Green New Deal neu ausrichten. Dabei sollten wir auf verbindliche Standards setzen statt auf eine veraltete Freihandelsidee, deren "Freiheit" darin besteht, sich nicht an solche Standards zu halten. Wir sollten darüber hinaus nach internationalen Partner*innen für einen nachhaltigen Entwicklungsweg suchen. Seien es die USA unter Joe Biden, der gegenwärtig dabei ist, die amerikanische Wirtschaft mit einem großen Investitionspaket zu erneuern, oder Entwicklungs- und Schwellenländer, die diesen sozial-ökologischen Entwicklungsweg mit der EU gehen wollen.
Freiheit bedeutet heute, dass wir uns die demokratische Gestaltungsfähigkeit und ein gutes Leben auch angesichts der Verwerfungen des Klimawandels erhalten. Um dies zu erreichen, brauchen wir nicht mehr Freihandel, sondern einen Handel, der der Freiheit dient, und eine Wende zum nachhaltigen Wirtschaften.
Katja Kipping ist sozialpolitische Sprecherin der Linken-Fraktion im Deutschen Bundestag sowie ehemalige Vorsitzende ihrer Partei. Im wöchentlichen Wechsel mit Konstantin Kuhle schreibt sie die Kolumne "Kipping oder Kuhle" bei ntv.de.
Quelle: ntv.de









