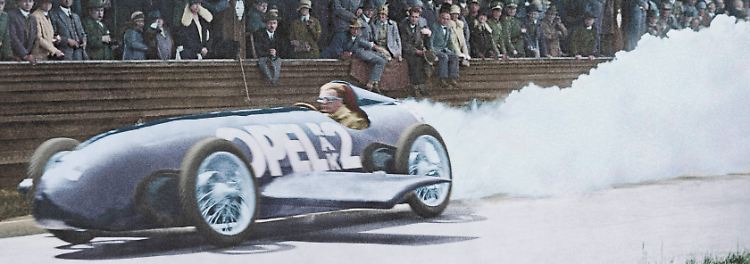Nordrhein-Westfalen Forscher: Mehr Stichwahlen und weniger Wahlbeteiligung
29.09.2025, 11:22 Uhr
(Foto: Dieter Menne/dpa)
Diesmal gab es mehr Stichwahlen, aber weniger Menschen stimmten ab als beim ersten Wahlgang zwei Wochen zuvor. Warum ist das so und was kann laut Politikforschung dennoch mobilisieren?
Bochum (dpa/lnw) - Mit fast 150 Fällen gab es diesmal besonders viele Stichwahlen, mit einer mancherorts aber geringer Wahlbeteiligung: Bei der Kommunalwahl in NRW habe sich der Trend gezeigt, dass zunehmend Vertreter kleinerer Parteien wie Volt, BSW oder unabhängiger Wählervereinigungen für Kommunalparlamente, aber auch mit eigenen Bewerbern für Spitzenämter kandidierten, sagt Politikwissenschaftler Oliver Lembcke. Unter dem Strich nehme der Einfluss der größeren Parteien tendenziell ab, der Einfluss der kleineren zu.
Anders als bei der Bundestagswahl und den Landtagswahlen gibt es bei Kommunalwahlen keine Fünf-Prozent-Hürde für Parteien, um in einen Kreistag oder Stadtrat gewählt zu werden. Das schaffe grundsätzlich einen Anreiz, sich mit Blick auf Kommunalparlamente zu engagieren. Die kleineren Gruppierungen könnten zudem mit eigenen Kandidaten für Spitzenämter spürbar an Einfluss gewinnen – selbst wenn sie praktisch keine Chancen auf den Posten-Gewinn haben.
Denn: Bewerber kleiner Parteien oder Vereinigungen einigen sich mitunter bereits vor der Wahl mit besonders aussichtsreichen Kandidaten, diese im Falle einer Stichwahl zu unterstützen, um im Gegenzug bei einem Wahlsieg berücksichtigt zu werden, etwa mit einem Dezernat betraut zu werden. Solche Absprachen seien nicht ungewöhnlich, sagt der Bochumer Forscher der Deutschen Presse-Agentur-
Grundsätzlich brauche es angesichts einer Fragmentierung in der Parteienlandschaft auch auf kommunaler Ebene feste Absprachen und immer stärker eine lagerübergreifende Zusammenarbeit, um stabile Mehrheiten zu gewinnen und handlungsfähig zu sein.
Warum ist die Beteiligung an Stichwahlen in der Regel geringer?
Wenn bei einer Stichwahl keiner der beiden noch verbliebenen Bewerber der eigene Wunschkandidat ist, kann der Anreiz fehlen, noch ein zweites Mal abzustimmen, stellt Lembcke klar. Aber: "Die Menschen gehen wählen, wenn sie überzeugt sind, dass es wirklich um etwas geht."
Als Beispiel für einen solchen Mobilisierungseffekt führte er Duisburg an. Dort sei die Beteiligung an der Stichwahl vergleichsweise hoch ausgefallen (48,36 Prozent) – offenbar, weil die Mehrheit der dortigen Zivilgesellschaft einen AfD-Oberbürgermeister verhindern wollte, sagt der Forscher.
Grundsätzlich zeige sich bei Stichwahlen eine "gewisse Indifferenz". Auf die Frage, ob solche Stichwahlen dennoch sinnvoll seien, sagt Lembcke, diese seien "funktional" und bedeuteten eine Absicherung für die gewählten Verwaltungsbeamten an der Spitze. Man könne Stichwahlen in puncto Wahlbeteiligung nicht mit anderen Wahlen vergleichen.
Quelle: dpa