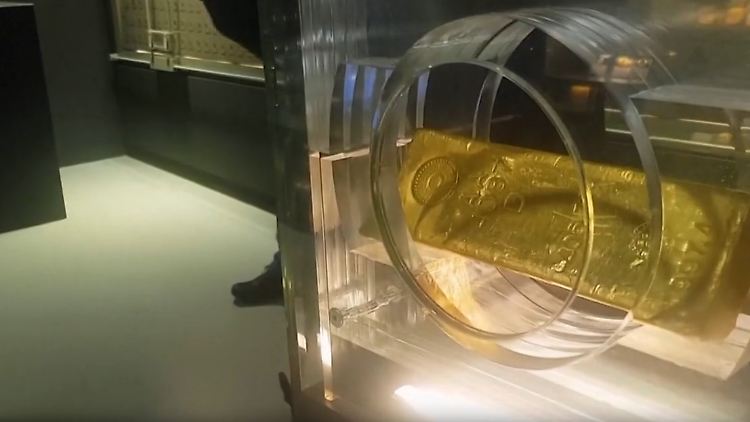Ein Steuerfahnder bei der Arbeit.
(Foto: dpa)
Grüne und SPD wollen Spitzenverdiener zur Kasse bitten. Die Steuerdebatte verkennt die Realitäten: Die Mittelschicht zahlt in Deutschland zu viel, weil Geringverdiener zu wenig verdienen, Superreiche und Großkonzerne sich um den Fiskus herumtricksen. Fünf Thesen zum deutschen Steuersystem.
In Deutschland tobt eine Debatte über mehr Steuergerechtigkeit. Wer sollte stärker zur Kasse gebeten werden? Wer hat zu wenig? n-tv.de hat die bekanntesten Steuer-Mythen überprüft.
Besserverdienende zahlen nicht übermäßig viele Steuern
Die Spitzenverdiener tragen mit ihrem Steueraufkommen überdurchschnittlich viel zum Gemeinwesen bei – das ist ein gängiges Argument, mit dem viele der oberen Zehntausend hinter vorgehaltener Hand Steuerhinterziehung rechtfertigen oder zumindest gerne als Kavaliersdelikt abtun. Es stimmt nur auf den ersten Blick: Laut Statistischem Bundesamt zahlen die reichsten ein Prozent der Steuerzahler 23,3 Prozent der gesamten Einkommensteuer. Menschen, die mehr als 219.000 Euro jährlich verdienen, tragen also rund ein Viertel der Gesamtlast.
Umgekehrt gilt damit aber auch: Drei Viertel der Einkommensteuer werden von 99 Prozent, also der Masse bezahlt. Hinzu kommt: Die Einkommensteuer ist nicht die einzige Steuer, die das System trägt: 2010 machte sie nur rund 34 Prozent der gesamten Steuereinnahmen des Staates aus. Weitere 34 Prozent holt sich der Staat über die Mehrwertsteuer. Und die trifft jeden Menschen beim Einkaufen gleich, egal ob er Millionär oder Hartz-IV-Empfänger ist. Geringverdiener werden also vom Staat wie Reiche überdurchschnittlich belastet, nur an anderer Stelle – und vermutlich schmerzt es sie weit mehr, weil sie eben ein kleines und kein großes Einkommen haben.
Die Sozialabgaben in Deutschland sind zu hoch
Auch wenn die Politik seit Jahren dagegen kämpft: Die Sozialabgaben sind in Deutschland im Vergleich zu den anderen entwickelten Industrieländern immer noch überdurchschnittlich hoch. Laut OECD ist der Anteil der Sozialversicherungsbeiträge an der Gesamtwirtschaft in den letzten zehn Jahren nahezu konstant geblieben: Im Jahr 2000 lag er bei 14,6 Prozent, 2011 waren es immer noch 14,3 Prozent. In allen OECD-Ländern lag die Sozialabgabenquote 2010 dagegen im Schnitt nur bei 9,5 Prozent.
Das liegt vor allem daran, dass sich Deutschland weiterhin ein recht großzügiges Sozialsystem leistet. Selbst in den südeuropäischen Krisenländern Griechenland, Spanien, Italien und Portugal, wo nach Meinung vieler Deutscher mit dem Euro-Eintritt sozialpolitische Wohltaten auf Kosten des Staates mit der Gießkanne verteilt wurden, lag 2010 laut OECD die Sozialabgabenquote niedriger. Dass hohe Lohnnebenkosten auf Dauer aber durchaus der Wettbewerbsfähigkeit schaden können, zeigt das Beispiel Frankreich: Kein OECD-Land erhebt im Verhältnis zu seiner Wirtschaftsleistung mehr Sozialabgaben – nun steckt die Grande Nation in der Wachstumsfalle.
Unternehmen zahlen in Deutschland keine hohen Steuern
Dass Unternehmen in Deutschland zu hohe Steuern auf ihre Profite zahlen, ist ein Märchen. Gerade Deutschland hat die Körperschafssteuersätze in den letzten zehn Jahren massiv gesenkt – von 40 Prozent im Jahr 2000 auf gerade noch 15 Prozent im Jahr 2012. Auch inklusive der Gewerbesteuer, die die Kommunen zusätzlich bei den Konzernen abzwacken, zahlen deutsche Unternehmen laut OECD damit inzwischen geringere Sätze als in den vermeintlich unternehmerfreundlicheren USA. Gerade einmal 2,3 Prozent der gesamten Steuereinnahmen waren 2010 Körperschaftssteuer, nur 6,7 Prozent Gewerbesteuer.
Problematisch ist allerdings, dass ein Großteil der Unternehmensprofite im deutschen System doppelt besteuert wird: Zuerst als Gewinn, den Firmen direkt abführen. Der Rest wird als Kapitalerträge an Aktionäre und Eigentümer ausgeschüttet, die darauf nocheinmal Steuern zahlen. Da aber viele deutsche Firmen Mittelständler und Familienunternehmen sind, die nur einem oder wenigen Besitzern gehören, treffen höhere Einkommensteuern also auch immer Unternehmer. Genau deshalb zog der Realo-Flügel der Grünen nur sehr widerwillig bei den Steuererhöhungsplänen mit.
Multinationale Konzerne wie Apple, Google, Starbucks und Amazon spielen dagegen seit Jahren Deutschland und andere Länder gegeneinander aus, verschieben ihre Gewinne in Steueroasen und tricksen so den Fiskus aus. Finanzinstitute nutzen hingegen Gesetzeslücken beim sogenannten Dividendenstripping gnadenlos aus, um den Staat gleich mehrfach um die Kapitalertragsteuer zu erleichtern. Man kann diese Umgehungsstrategien zurecht als unmoralisch bejammern. Fakt ist, dass Deutschland und andere Staaten dagegen viel zu lange viel zu wenig getan haben. Auch deshalb sucht Finanzminister Schäuble nun verstärkt bei den G20-Ländern Verbündete im Kampf gegen Steuertricks von Unternehmen.
Superreiche zahlen zu wenig
Dieser Vorwurf stimmt gleich zweifach: Abgesehen von den USA lässt kaum ein OECD-Land seine Superreichen so ungeschoren davonkommen wie Deutschland. Für die meisten Parteien in Deutschland ist das Wort „Vermögenssteuer“ gleichbedeutend mit „Stimmenverlust“. Die sogenannte Reichensteuer von 45 Prozent – also der höchste Steuersatz für Superverdiener – greift hierzulande erst ab einem Einkommen von 250.000 Euro.
Franzosen müssen ihn schon ab 150.000 Euro bezahlen. Für Italiener sind bereits ab 75.000 Euro 43 Prozent fällig, für Belgier gar ab 36.300 Euro schon 50 Prozent. Österreich erhebt den Spitzensatz von 50 Prozent schon ab 60.000 Euro, Großbritannen schon bei 150.000 Pfund (180.000 Euro). Selbst in Griechenland gehen ab 100.000 Euro 45 Prozent an den Staat.
Gleichzeitig hintergehen ausgerechnet diese Topverdiener in Deutschland das Gemeinwesen. Denn nicht bloß griechische Millionäre, sondern viele Superreiche hintergehen wie Uli Hoeneß den Fiskus mit krimineller Energie: 100.000 Deutsche sollen laut einem Bericht ihr Geld in Finanzparadiesen parken. Inzwischen geloben selbst die Schweizer Banken Besserung und drängen ihre Kunden, sich beim Finanzamt selbst anzuzeigen. Die Schweiz will künftig kein Schwarzgeld mehr, das ist nun zumindest offizielle Linie.
Die Mittelschicht wird zu stark belastet
Die Folge dieser Probleme ist, dass Menschen mit mittlerem Einkommen vom deutschen Fiskus umso stärker gemolken werden. Er ist nur logisch: Solange Superreiche und Großkonzerne sich mit Finanztricks vor der Steuer drücken können, muss der Staat eben denen umso tiefer in die Tasche greifen, die nicht einfach auf die Virgin Islands oder in die Schweiz verduften können – der Mittelschicht.
Hinzu kommt, dass die Mittelklasse in Deutschland nicht nur von ganz oben, sondern auch von ganz unten unter Druck gerät: Nicht nur superreiche Betrüger zahlen keine Steuern, sondern auch die Deutschen, die der Staat von der Steuer befreit, weil sie nur wenig mehr als das Existenzminimum haben: Rund 11 Mio. Steuerpflichtige verdienen jährlich 10.000 Euro oder weniger und müssen so gut wie oder gar keine Einkommensteuer zahlen. Solange sich daran nichts ändert, bleibt Deutschlands Steuersystem eine Dreiklassengesellschaft: Unten ist zu wenig da, als das gezahlt werden könnte, oben müsste gezahlt werden, aber es wird betrogen, und in der Mitte kassiert der Staat ab – so könnte man es etwas überspitzt auf den Punkt bringen.
Quelle: ntv.de