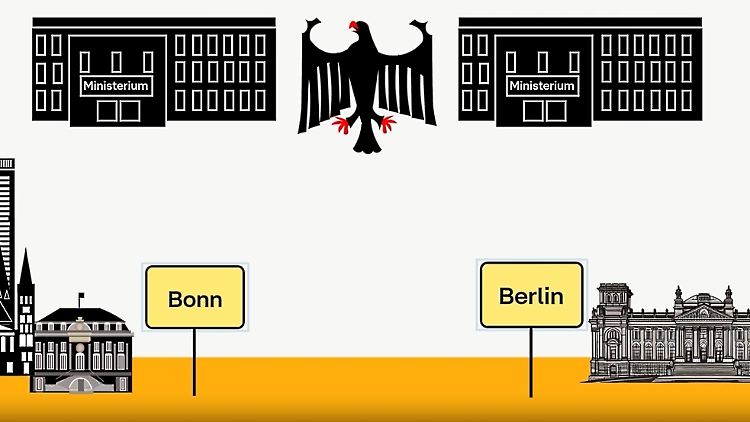Vermögende Kunden und ihr Image Die teure Suche nach den schwarzen Schafen
23.07.2013, 13:54 Uhr
Unlautere Geschäfte in Schurkenstaaten? Besser schon vorher wissen, wen mal als vermögenden Kunden gewinnt.
(Foto: picture alliance / dpa)
Steuerhinterziehung? Geldwäsche? Unlautere Geschäfte in Schurkenstaaten? Wenn sich Banken in der Vermögensverwaltung eines nicht mehr leisten können, dann sind es Privatkunden mit einer solchen Geschichte. Denn die schwarzen Schafe sind inzwischen in zweierlei Hinsicht geschäftsschädigend: Sie können nicht nur den Ruf der Geldhäuser ruinieren und grundsolide Klienten abschrecken. Sie ziehen auch teure Geldstrafen mit sich, wenn die Regulierer ihnen erst mal auf die Schliche gekommen sind und die Banken im Verdacht haben, sie zu decken. Also steuert die Branche um - seit einiger Zeit wird jeder neue Kunde - und bringt er auch noch so viel Vermögen mit - auf Herz und Nieren geprüft. Allein: Das kostet Zeit und sehr viel Geld.
Sinnvoll ist es allemal. Denn in den westlichen Industriestaaten mit schrumpfender Bevölkerungszahl kommen kaum noch neue Millionäre oder Milliardäre hinzu, die Märkte sind gesättigt. In Asien und dem Nahen Osten dagegen werden die Menschen immer reicher, das Wirtschaftswachstum ist rasant. Entsprechend kommen immer mehr Neugelder, die die europäischen oder US-Institute im Private Banking einsammeln, aus eben diesen Regionen.
"Es ist teuer, das stimmt"
"Im Moment wächst die internationale Kundenbasis besonders schnell", erläutert Paul Kearney, der sich beim britischen Vermögensverwalter Kleinwort Benson um die Privatkunden kümmert. Das führe zu entsprechend steigenden Kosten für sein Haus in den nächsten ein bis zwei Jahren. Im Moment gibt sein Team zwischen 5000 und 25.000 Pfund aus, um jeden Neukunden zu durchleuchten - abhängig davon, aus welcher Region er kommt. Das frisst einen Teil der ohnehin immer dünner werdenden Margen gleich wieder auf, zumindest im ersten Jahr.
"Es ist teuer, das stimmt, aber so einfach wie früher ist es eben nicht mehr", sagt auch George King, oberster Portfolio-Stratege in der privaten Vermögensverwaltung der Royal Bank of Canada. "Das Risiko, den guten Ruf zu verlieren, oder die Gefahr von Strafzahlungen ist schlicht zu groß, als dass man die Prüfung nicht gründlich genug macht."
Schweizer Bankgeheimnis praktisch aufgehoben
Das mussten in der jüngeren Vergangenheit selbst einstige Vorzeigehäuser erleben: HSBC wurde von den US-Behörden zu einer hohen Geldstrafe verdonnert, weil die Geldwäschekontrollen in Ländern wie Mexiko zu lax waren. Und Standard Chartered geriet bei den US-Aufsehern ins Kreuzfeuer, weil die Bank gegen Iran-Sanktionen verstoßen haben soll.
Für die Schweizer Banken wiederum - Platzhirsche in der privaten Vermögensverwaltung, die vielen Kritikern als Hort der Steuerhinterziehung galten - brechen im kommenden Jahr neue Zeiten an: Dann wird gegenüber den USA das Schweizer Bankgeheimnis 2014 praktisch aufgehoben. Das heißt: UBS, Credit Suisse und Co. müssen Vermögen und Einnahmen von US-Kunden fortan direkt an die US-Steuerbehörden melden.
Im Zweifel eine Abfuhr
Mehr Transparenz heißt allerdings mehr Kosten. Die Banken ächzen darunter. Die fetten Jahre in der Vermögensverwaltung sind ohnehin längst vorbei, denn wegen der strengeren Regulierung, die mit einem höheren Dokumentationsaufwand einhergeht, bleibt immer weniger Provision bei den Kundenberatern hängen. Dass der Druck zunimmt, zeigt auch die jüngste Studie der Marktforschungsfirma Scorpio Partnership: Demnach verwalteten Finanzinstitute für reiche Privatkunden 2012 weltweit 18,5 Billionen Dollar. Anders als 2011 gab es sogar Nettomittelzuflüsse im zweistelligen Prozentbereich. Doch die Gewinne, die 2011 noch um gut zwölf Prozent gestiegen waren, wuchsen im vergangenen Jahr gerade noch um fünf Prozent. Viele Häuser hätten die Kosten einfach nicht im Griff, stellte Scorpio nüchtern fest.
Manche Banken ziehen deshalb bei der Auswahl neuer Kunden eine ganz einfache Konsequenz: Wenn sich die "Aufnahmeprüfung" als zu komplex erweist oder der Account nicht groß genug ist, um damit rentabel zu arbeiten, gibt es eben eine Abfuhr. Gleiches gilt, wenn der Instinkt gegen das Geschäft spricht: "Man muss die Herkunft der Gelder, mit denen man arbeitet, sehr genau kennen", betont Rupert Robinson, Vorstandschef von Signia Private Wealth. "Ist das nicht der Fall, dann ist die Antwort ganz einfach: Man lehnt ab." Gerade Betrug lasse sich äußerst schwer nachweisen. "Wenn man nur den leisesten Zweifel hat, dann muss man 'nein' sagen."
Quelle: ntv.de, Kathrin Jones, rts