Bofinger plädiert für den Euro 2.0 "Ohne Euro ginge es uns schlechter"
27.09.2012, 11:00 UhrDie Rückkehr zur D-Mark wäre ein Desaster, warnt der Wirtschaftsweise Peter Bofinger in seinem neuen Buch. Statt die Vergangenheit zu verklären, sollte deshalb besser die Währungsunion gerettet werden. Mit dem Ökonomen sprach n-tv.de über D-Mark-Nostalgie, Sparpakete und die Macht der Finanzmärkte.
n-tv.de: "Deutschland braucht den Euro", heißt es im Titel Ihres Buches. Ginge es Deutschland ohne den Euro nicht viel besser?
Peter Bofinger: Nein. Sie müssen sich überlegen, was in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren ohne den Euro passiert wäre. Wir hätten natürlich auch mit der D-Mark versucht, über Lohnzurückhaltung möglichst wettbewerbsfähig zu werden. Dann wäre den Devisenmärkten in den Jahren 2005 oder 2006 aufgefallen, zu was für großen Leistungsbilanzüberschüssen das in Deutschland und zu welchen Leistungsbilanzdefiziten das in anderen Ländern geführt hätte. Die Konsequenz wäre eine massive Aufwertung der D-Mark gewesen, die die gewonnene Wettbewerbsfähigkeit wieder zunichtegemacht hätte und wahrscheinlich noch darüber hinausgegangen wäre.
Die seit Jahren anhaltende Finanzkrise zeigt doch überdeutlich, dass Märkte in ihrem Urteil oft danebenliegen und zu Übertreibungen neigen. Dies gilt insbesondere für den Devisenmarkt. Unter einer solchen Entwicklung leiden derzeit beispielsweise die Schweiz und Japan, das durch eine unkontrollierte Aufwertung in die Deflation getrieben wurde. Die Wettbewerbsfähigkeit sinkt und dennoch sitzt das Land durch seine Interventionen am Devisenmarkt auf einem gewaltigen Berg von fremden Staatsanleihen, für die es das Ausfallrisiko tragen muss.
Aber selbst zu Zeiten der Mark war Deutschland Exportweltmeister.
Damals war die Exportabhängigkeit Deutschlands nur halb so hoch wie heute. Und es gab das Europäische Währungssystem, mit dem versucht wurde, die Währungen über Festkurse zu stabilisieren. Doch auch dieses System tendierte zu massiven Krisen. Das hat in den Jahren 1992/93 zu einer starken Aufwertung der D-Mark geführt und der deutschen Wirtschaft ein gravierendes Standortproblem beschert.
Haben Sie Verständnis dafür, dass sich viele Deutsche nach der Mark zurücksehnen?
Es ist immer so, dass man die Vergangenheit verklärt und man annimmt, früher sei alles besser gewesen. Das ist völlig legitim. Aber auf den globalen Märkten gibt es keine Idylle, das zeigt nicht zuletzt der Blick nach Japan oder nach China, wo der Wechselkurs mit Interventionen in Billionen-Höhe stabilisiert werden musste. Wenn wir zur D-Mark zurückkehren, legen wir das Schicksal unserer Wirtschaft in die Hände der schwer berechenbaren Devisenmärkte. Und was die anrichten können, zeigt uns doch die gegenwärtige Krise. Eine Rückkehr zur Mark ist viel riskanter als ein Festhalten am Euro, sofern es uns gelingt, die Währungsunion vernünftig weiter zu entwickeln.
Kann der Euro denn zum Funktionieren gebracht werden?
Im Kern geht es darum, eine übermäßige Verschuldung der Euro-Länder jenseits einer Verschuldungsmarke von 60 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung in einem Zeitraum von 20 bis 25 Jahren auf Basis einer gemeinsamen Haftung abzubauen.
Alle Schulden der Teilnehmerstaaten oberhalb der Marke von 60 Prozent der Wirtschaftsleistung sollen in den Fonds eingebracht werden. Zu Beginn wird also für jedes Land ein konkreter Euro-Betrag an Schulden vertraglich festgelegt, den sie somit auslagern können.
Der Schuldentilgungsfonds würde einerseits Anleihen ausgeben, um mit Einnahmen daraus die Teilnehmerländer zu refinanzieren. Für diese Papiere würden die Länder gemeinsam haften. Dadurch ergäbe sich etwa für die Krisenländer ein Zinsvorteil, bezogen auf die Refinanzierung der ausgelagerten Schulden. Für Länder wie Deutschland, das für kurzfristige Kreditaufnahmen derzeit praktisch keine Zinsen zahlen muss, wäre das Ergebnis wohl eine Verteuerung.
Auf der anderen Seite verpflichten sich die Länder des Fonds zu Zahlungen. Die Höhe der jährlichen Zahlungen bemisst sich im Grundsatz am Volumen der ausgelagerten Schulden. Im ersten Jahr, das den Orientierungspunkt für die Zahlungen in den Jahren danach bildet, überweist das Land die anteilig auf seine eingebrachten Schulden entfallenden Zinszahlungen. Darüber hinaus muss der Staat zusätzlich ein Prozent für die Tilgung überweisen. Grundsätzlich ist angestrebt, die Zahlungen so anzusetzen, dass die Länder ihre ausgelagerten Schulden nach maximal 25 Jahren getilgt haben.
Allerdings müssen sich die Problemländer Auflagen gefallen lassen im Gegenzug zu den Zinsvorteilen. Eine Möglichkeit wäre, dass sie die Tilgungszahlungen durch neue Steuern finanzieren müssen, oder dass sie Sicherheiten hinterlegen müssen.
Die bei den Staaten verbleibenden Schulden sollten dann nicht mehr die Marke von 60 Prozent des BIP übersteigen. Abgesichert werden sollen die Schuldenbremsen in den nationalen Verfassungen. Der Fonds soll allen Euro-Ländern offenstehen, für die noch kein Hilfsprogramm gilt, so der Vorschlag der "Fünf Weisen". Keine Kandidaten wären demnach Griechenland, Irland und Portugal. Sie sollten dem Fonds zwar formell beitreten können, ihre übermäßigen Schulden aber erst nach Abschluss ihres jeweiligen Anpassungsprogramms dorthin auslagern können.
Eine zentrale These des Buchs ist, dass das gegenwärtige Durchwurschteln nicht sinnvoll ist. Zum einen ist es ordnungspolitisch bedenklich, wenn die EZB die ganze Last der Stabilisierung tragen muss. Zum anderen sind gerade ganze Volkswirtschaften dabei, sich regelrecht kaputtzusparen. Dabei sind wir doch in der Lage, die Währungsunion fortzuentwickeln und stabile Rahmenbedingungen zu schaffen. Damit sollten wir am besten sofort beginnen. Die fiskalische Integration muss deutlich verstärkt werden. Wir brauchen direkte Durchgriffsrechte für einen europäischen Finanzminister, der fiskalische Verstöße von Mitgliedsländern ahnden und notfalls Gegenmaßnahmen erzwingen kann. Dieses Amt müsste natürlich durch das Europäische Parlament legitimiert sein. Damit würde das derzeitige Demokratiedefizit reduziert.
Gleichzeitig müssen wir Mechanismen entwickeln, um Länder vor Finanzmärkten zu schützen, die immer wieder von Panikattacken und Angststörungen heimgesucht werden. Ich habe das Phänomen im Buch als Bond-Run bezeichnet, als Analogie zum Bank-Run. Einige verunsicherte Investoren werfen plötzlich ihre Staatsanleihen auf den Markt. Damit steigen die Zinsen und es wird für einen Staat schwieriger, seine Schulden zu bedienen. Das führt dazu, dass sich weitere Investoren von den Anleihen dieses Landes trennen, die Zinsen steigen noch weiter an. Das führt dazu, dass das Land von den Rating-Agenturen abgewertet wird und die Anleger werden noch mehr verunsichert. Für einen Staat ist es außerordentlich schwierig, einem solchen Teufelskreis alleine standzuhalten. Hier braucht man eine Form der gemeinschaftlichen Haftung, beispielsweise durch den vom Sachverständigenrat vorgeschlagenen Schuldentilgungsfonds.
Sind solche weitreichenden Pläne in dieser Eurozone überhaupt umsetzbar?
Ich glaube schon, dass es dafür eine Chance gib. Deutschland muss den anderen Ländern die Gemeinschaftshaftung anbieten. Im Gegenzug müssen diese allerdings auf Souveränität verzichten. Auch Frankreich würde merken, dass das kein schlechtes Geschäft ist. Wenn Präsident Hollande heute ein expansives Fiskalprogramm einleiten würde, dann würde Frankreich schnell Probleme auf den Finanzmärkten bekommen. Die Souveränität von Nationalstaaten ist innerhalb des Euroraums also ohnehin schon sehr eingeschränkt.
In Deutschland ist gemeinsame Haftung für Schulden nicht gerade populär …
Es ist in der Tat nicht einfach, die deutsche Bevölkerung davon zu überzeugen, dass es uns mit einer weiterentwickelten Währungsunion besser gehen würde als mit der D-Mark. Aber das ist doch genau die Diskussion, die wir führen müssen. Wir führen seit zwei, drei Jahren eine sehr rückwärtsgerichtete Diskussion, in der wir vor allem darüber reden, was alles falsch gelaufen ist. Wir klagen und jammern. So berechtigt das ist, wir fragen uns nicht, wo wir hinwollen. Wir denken nicht über die nötigen Schritte nach, um das zu erreichen. Wenn jemand zurück zu D-Mark will, dann soll er das auch klar sagen. Dann können wir die Risiken und Konsequenzen dieses Schrittes vergleichen mit den Risiken und Konsequenzen, die sich aus einer weiterentwickelten Währungsunion ergeben.
In einer solchen Diskussion stehen Sie als keynesianisch orientierter Ökonom gegen eine neo-klassische Übermacht.
Na ja, Sie müssen schon ein wenig über die Landesgrenzen hinaussehen. Im Ausland ist das ja durchaus anders. Außerdem hat sich der Sachverständigenrat einheitlich für den Euro und für den Schuldentilgungspakt ausgesprochen. Es gibt auch in Deutschland viele renommierte Ökonomen, die es vorziehen, die Währungsunion weiterzuentwickeln, statt die Eurozone implodieren zu lassen.
Geht das auch mit Griechenland?
Griechenland ist sicher kein einfacher Fall. Die Situation in dem Land ist aber auch das Ergebnis einer falschen Therapie. Man hat versucht, viel zu schnell viel zu viel zu sparen. Kein Land hat in der Nachkriegszeit versucht, so umfangreiche Sparmaßnahmen umzusetzen – ohne zugleich die Währung abwerten zu können und dadurch die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Man hätte mit mehr Geduld, mit einem längeren Atem an die Sache herangehen müssen. Dann wäre der wirtschaftliche Einbruch sehr viel weniger heftig gewesen. Griechenland ist im Grunde ein abschreckendes Beispiel, das zeigt, wohin überzogenes Sparen führt. Wir sollten uns das bewusst machen, damit es Spanien oder Portugal in ein oder zwei Jahren nicht ähnlich geht. Der Internationale Währungsfonds hat noch im April 2011 geglaubt, dass es 2012 wieder eine positive Wachstumsrate in Griechenland gibt. Die Bremseffekte der Sparpolitik wurden immens unterschätzt.
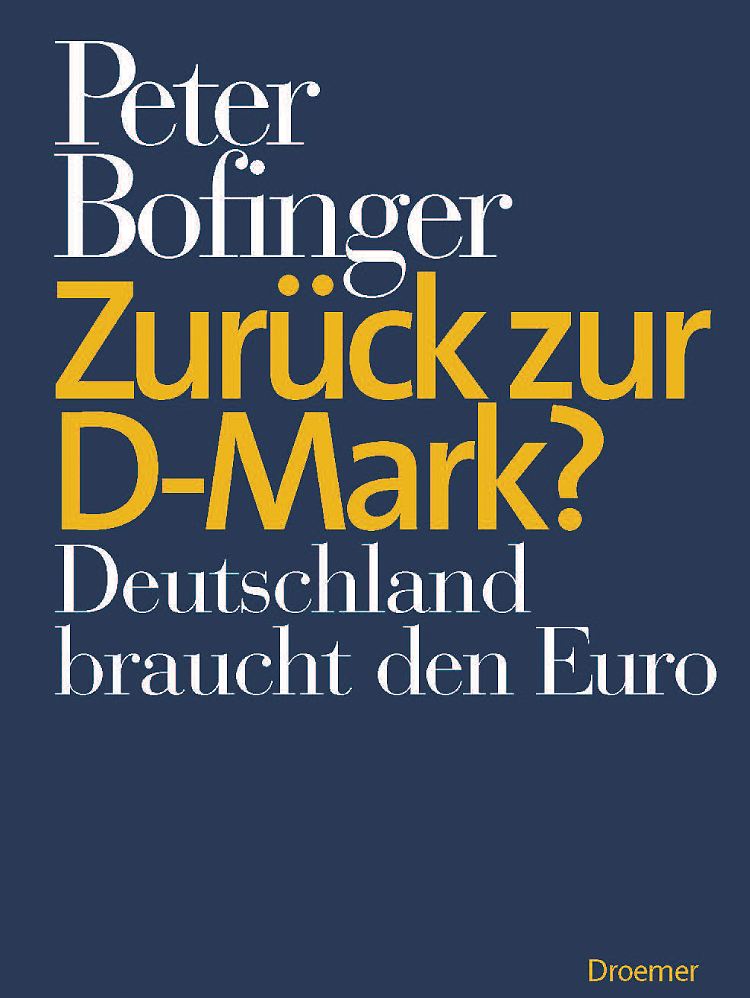
Das Buch erscheint am 1. Oktober im Verlag Droemer-Knaur und kostet 18 Euro.
Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler sagte im Juni, ein Austritt Griechenlands habe für ihn längst seinen Schrecken verloren …
Abgesehen von den Konsequenzen, die ein solcher Schritt für Griechenland hätte: In Italien und Spanien fließt derzeit schon massiv Kapital ab. Dort ist das Vertrauen in die Finanzinstitute stark erschüttert. Das heißt doch, dass der Schrecken bereits da ist, die Kapitalflucht ist im Gange. Die von Herrn Hans-Werner Sinn so oft erwähnten Risiken der Target-Salden spiegeln genau diese Entwicklung wider. Wenn Griechenland tatsächlich austritt, werden sich diese Prozesse noch verstärken. Spanier, Portugiesen oder Iren werden sich dann überlegen, ob sie ihr Geld nicht besser von ihren Konten abheben sollten, um es in Sicherheit zu bringen. Es droht also ein Bank-Run.
Die erwähnten Vorschläge des Sachverständigenrats stoßen bei der Bundesregierung nicht auf Gegenliebe. Ärgert Sie das?
Es ist schon so, dass wir den Schuldentilgungspakt im vergangenen November vorgeschlagen haben. Damals hatten wir ganz explizit betont: Wenn die Eurozone keine fiskalischen Formen der Absicherung von Krisenländern findet, dann wird die EZB in die Verantwortung genommen. Deswegen ist es bedauerlich, dass unser Modell, das international sehr gut angekommen ist, nicht umgesetzt wurde. Die Bundesregierung hat mit ihrem Kurs die EZB letztlich gezwungen, durch Anleihekäufe in die Staatsfinanzierung einzusteigen. Das ist kein guter Weg.
Gibt es den Euro in fünf Jahren noch?
Ich hoffe es, aber wir müssen dafür noch viel arbeiten. Es kommt aber nicht nur darauf an, dass es den Euro noch gibt. Das Entscheidende ist doch, dass es im Euroraum wirtschaftlichen Wohlstand und politische Stabilität gibt. Ein Euro, den es nur durch von Rezessionen heimgesuchte Volkswirtschaften oder grenzenlose EZB-Staatsfinanzierung gibt, ist alles andere als wünschenswert.
Mit Peter Bofinger sprach Jan Gänger
"Zurück zur D-Mark? Deutschland braucht den Euro" bei amazon bestellen.
Quelle: ntv.de








