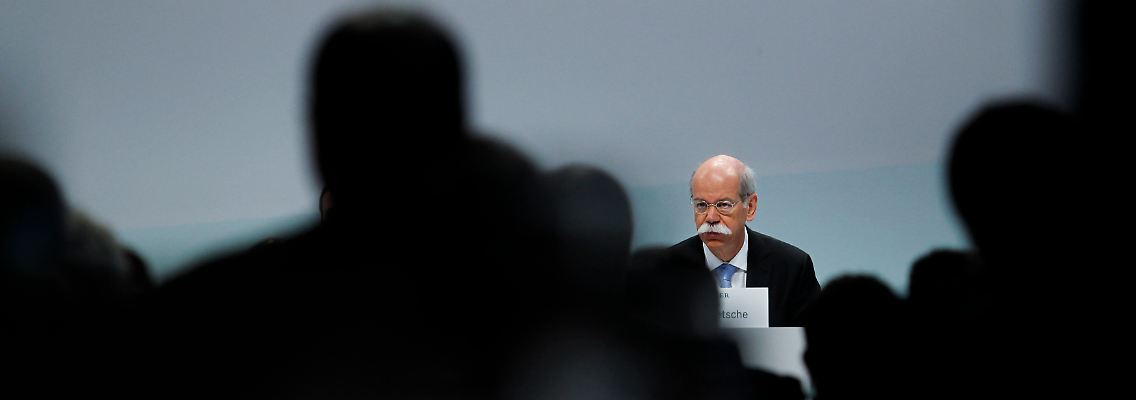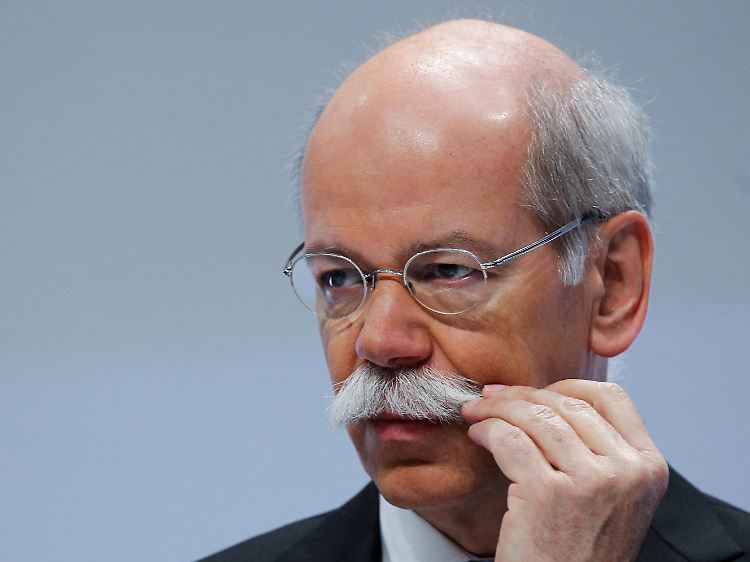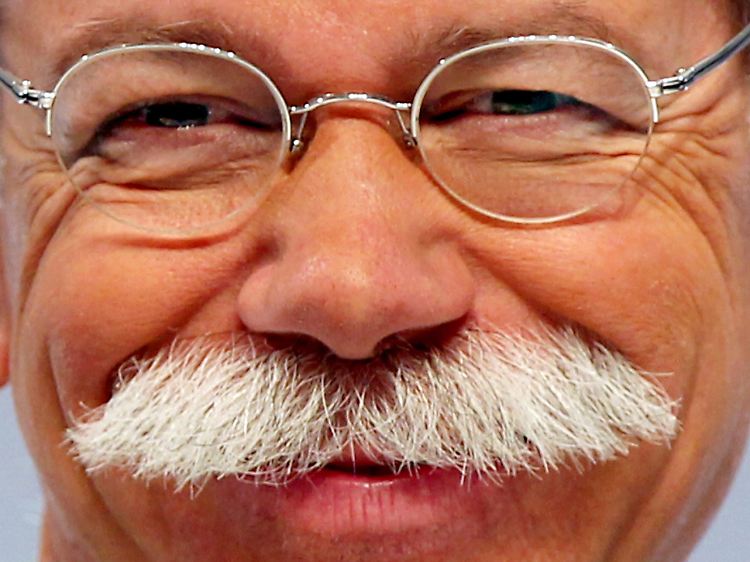Viele Baustellen bei Daimler Woran Zetsche arbeitet
12.04.2011, 21:17 Uhr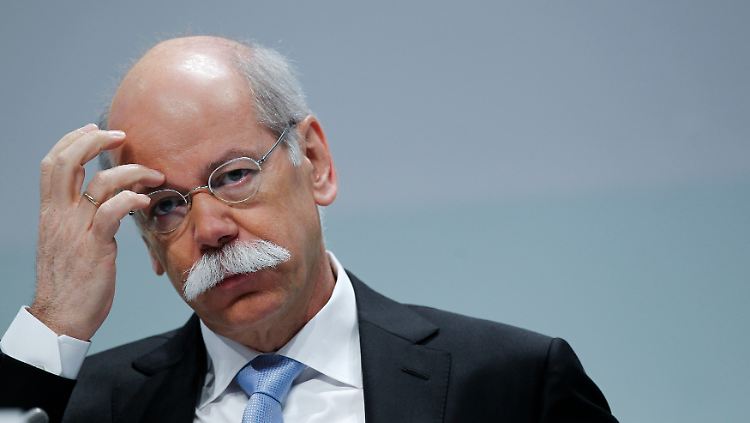
Denkt nach: Dieter Zetsche.
(Foto: REUTERS)
Zur Hauptversammlung kurven die Gedanken von Daimler-Chef Dieter Zetsche um eine ganze Reihe komplizierter As: Absatzzahlen, Analysten und Aktionäre, Arbeitsplätze, Allianzen und alternative Antriebsformen sind da erst der Anfang. Eine Auswahl.
In den 125 Jahren nach der Erfindung des Automobils ist aus den Ideen von Gottlieb Daimler und Carl Benz ein erfolgreicher Weltkonzern entstanden: Die Daimler AG verkauft Autos, Busse und Lkw in beinahe allen Ländern der Welt. Im vergangenen Jahr waren es 1,9 Mio. Fahrzeuge. Daimler-Werke stehen auf fünf Kontinenten. 260.000 Menschen verdienen dort ihren Lebensunterhalt. Die Daimler-Marken heißen AMG, BharatBenz, Freightliner, Fuso, Maybach, Mercedes-Benz, Orion, Setra, Smart, Thomas Built Buses und Western Star. Der Umsatz lag 2010 bei 97,8 Mrd. Euro, der Nettogewinn bei 4,7 Milliarden.
Mitte April lädt Daimler-Chef Dieter Zetsche nun die Aktionäre zur Jubiläumshauptversammlung nach Berlin ein. Dort geht es nicht nur um die Erträge aus den Geschäftsfeldern "Mercedes-Benz Cars", "Daimler Trucks", "Mercedes-Benz Vans", "Daimler Buses" und "Daimler Financial Services" - wird die Aktionäre wohl nicht lange aufhalten. Es geht bei dem Treffen wohl mehr um die Frage, wie der Weltkonzern seine Marktanteile halten oder ausbauen kann. Woran denkt Dieter Zetsche?
Die Lage in Japan
Nach dem großen Erdbeben und den Zerstörungen durch den Tsunami musste Daimler die Lkw-Produktion am Standort Kawasaki für mehrere Tage einstellen. Eine Reihe von Zulieferbetrieben liegt in der Krisenregion im Nordosten. Daimler bleibe trotzdem produktionsfähig, hieß es in einer ersten Mitteilung.
Als Soforthilfe stellte der deutsche Konzern 2 Mio. Euro für Erdbeben- und Tsunami-Opfer bereit. Darüber hinaus bot Daimler der Regierung weitere Hilfe zum Beispiel durch Sachleistungen wie Busse oder Lkw an. Daimler hat durch seine Beteiligung an Mitsubishi Fuso, Mercedes-Benz Japan sowie Daimler Financial Services rund 13.000 Mitarbeiter im Land und arbeitet seit Jahren im Vertrieb unter anderem auch mit dem japanischen Hersteller Nissan zusammen.
Alternative Antriebsformen
Der weltgrößte Autozulieferer Bosch geht derweil mit Daimler eine Elektroauto-Allianz ein. Die Wege sind kurz: In einem Gemeinschaftsunternehmen wollen die beiden Stuttgarter Konzerne zusammen Elektromotoren entwickeln und produzieren. Der Startschuss solle bereits im nächsten Jahr fallen. Daimler und Bosch wollen sich mit dem Projekt angeblich auf den europäischen Markt konzentrieren. In Sachen Batterien hält sich Daimler an den Industriekonzern Evonik. Im Gemeinschaftsunternehmen Li-Tec werden Lithium-Ionen-Batterien für Autos hergestellt, die vom Jahr 2012 an serienmäßig in einen Elektro-Smart verbaut werden sollen. "Ein Schlüssel zum elektrischen Fahren bleibt in jedem Fall die Batterietechnologie", hatte Zetsche festgestellt. Hier arbeitet Daimler auch mit dem chinesischen Batterie- und Autohersteller BYD zusammen.
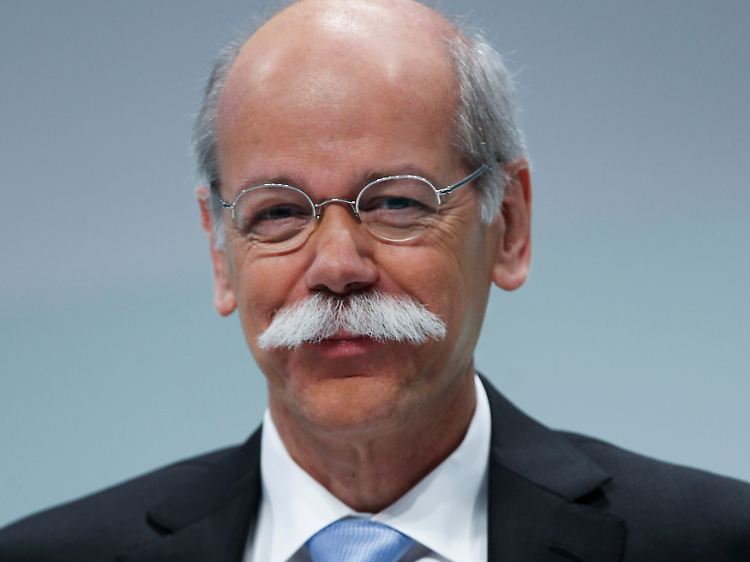
In der Zusammenarbeit liegt die Zukunft des Autobaus.
(Foto: REUTERS)
Beim E-Antrieb setzt Daimler auch auf das Knowhow des US-Autobauers Tesla. Vor der Kooperation mit Bosch waren auch Conti und Siemens als potenzielle Partner des schwäbischen Autobauers gehandelt worden. Diese Optionen seien nun vom Tisch, sagte eine Sprecherin. Der mächtige Daimler-Gesamtbetriebsratschef Erich Klemm hatte sich bis zum Schluss gegen einen Partner ausgesprochen. arbeitet Daimler an der Zukunft: Die Allianzen reichen dabei von der nach Zetsches Worten eher "weniger spektakulären" Zusammenarbeit mit dem bayerischen Konkurrenten BMW bis hin zur strategischen Partnerschaft mit Renault-Nissan.
Absatz: Zahlen und Ziele
Deutsche Autos verkaufen sich gut, und im Ausland gilt der berühmte Stern bei vielen Kunden als der Inbegriff für "the Oberklasse". In den ersten drei Monaten des Jahres konnte Daimler mit seiner Pkw-Marke Mercedes-Benz insgesamt rund 280.500 Fahrzeuge an die Kundschaft übergeben. Im wichtigsten Absatzmarkt der Welt, in den USA, liegt Daimler mit 53.000 verkauften Autos in etwa gleichauf mit BMW.
Die US-Kunden beginnen sich gerade erst von den tiefen Einbrüchen nach der Krise zu erholen. Beinahe alle Autobauer berichten über steigende Verkaufszahlen. Doch bei den Wachstumsraten hinkt Daimler hinterher. In den USA kam Mercedes-Benz zuletzt auf ein Quartalsplus von knapp 8,5 Prozent, BMW auf 14 Prozent. Audi dagegen, der Mitbewerber aus Ingolstadt mit dem VW-Konzern im Rücken, erreichte ein Plus von 20 Prozent auf knapp 25.500 Verkäufe. Der Abstand schmilzt. Daimler will in diesem Jahr einen Rekordabsatz einfahren, auch wenn das Wachstumstempo zuletzt nachlässt. Im Monat März kletterte der Absatz der Marken Mercedes-Benz, Smart, AMG und Maybach um 7,6 Prozent auf 129.622 Wagen. Für das gesamte erste Quartal betrug der Zuwachs 12,4 Prozent auf 305.533 weltweit verkaufte Autos. Mit neuen Modellen im Rücken will der Konzern im zweiten Quartal besser abschneiden.
Analysten und Tognum
Die geplante Übernahme des Friedrichshafener Motorenbauers Tognum stößt im Kreis der Analysten grundsätzlich durchaus auf Beifall. "Die Motoren-Sparte von Tognum wäre eine gute Ergänzung zum Produktportfolio von Daimler", meinte zum Beispiel Commerzbank-Analystin Yasmin Moschitz. Anfang April hatte Daimler zusammen mit dem britischen Triebwerkhersteller Rolls-Royce die Details für ihre Tognum-Offerte veröffentlicht. Tognum-Aktionäre können ihre Anteilsscheine bis einschließlich 18. Mai einreichen.
Geboten bekommen sie dafür 24 Euro je Aktie, ein Aufschlag "von rund 30 Prozent gegenüber dem Aktienkurs vor den ersten Marktgerüchten über mögliche Übernahme", wie man bei Daimler betont. Analysten gingen schnell davon aus, dass viele Aktionäre damit nicht zufrieden sein dürften. Jetzt wird gepokert: Immer mehr Anteilseigner des Friedrichshafener Konzerns halten die gebotenen 24 Euro für zu niedrig. Sie stärken stattdessen dem Tognum-Vorstand den Rücken, der selbst einen höheren Preis fordert. Wenn der Tognum-Kurs weiter über der Offerte liegt, werden auch die Kleinaktionäre wenig Lust verspüren, sich von ihren Aktien zu trennen.
Aktionäre und ihr Einfluss
Der überwiegende Teil der Daimler-Aktien liegt in der Hand institutioneller Investoren: Mit einem Anteil von 61,9 Prozent ist das Gewicht von Fonds, Banken und anderen Großaktionären gegenüber dem Vorjahr leicht gewachsen. Bekannte Namen befinden sich darunter: Der US-Investor Blackrock zum Beispiel, die Deutsche Bank, UBS und Barclays. Der Anteil der Privatanleger ging leicht zurück: Aktuellen Angaben zufolge halten sie derzeit 19,1 Prozent der Aktien. Größter Einzelaktionär ist weiterhin der emiratische Staatsfonds Aabar mit 9 Prozent. Der Ölstaat Kuwait hält 6,9 Prozent. Die Kooperation mit Renault und Nissan stützt sich auf 3,1 Prozent der Daimler-Papiere.
Größere Bewegung gab es bei der regionalen Verteilung der Anteilseigner. Ob institutionell oder privat: Der Anteil der Aktionäre aus Deutschland ging von 36,4 Prozent auf 28,2 Prozent zurück. Der Anteil der Investoren aus dem europäischen Ausland ist dagegen markant angeschwollen von 30,1 Prozent auf 36,9 Prozent. Der Einfluss der US-Investoren ging um 2 Prozent auf 15,4 Prozent zurück. Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihre Stellung unter den Daimler-Aktionären nicht verändert. Investoren von außerhalb, also weder Golf, noch Europa oder USA, haben ihren Anteil dagegen bis zum Stichtag 31. Dezember 2010 von 0,1 Prozent auf 3,6 Prozent ausgebaut.
Afrika und die Nutzfahrzeuge
In dieser Sparte röhren die Motoren: Daimler gilt als weltgrößter Hersteller von Nutzfahrzeugen. Im laufenden Jahr rechnet Daimler-Truck-Chef Andreas Renschler mit weiter steigenden Absatzzahlen. "2011 bleiben wir auf Wachstumskurs", sagte er Mitte März. Nun warten Aktionäre und Analysten auf eine Bestätigung. In ersten beiden Monaten des Jahres belief sich das Absatzplus auf 28 Prozent. Laut Renschler ist "das sicher nicht das Ende der Fahnenstange, unser Auftragseingang bestätigt das". Der Truck-Markt komme immer erst im Jahresverlauf richtig in Fahrt, meinte er.
Ende März gab Daimler außerdem noch Details eines "deutsch-emiratisch-algerischen" Gemeinschaftsprojekts bekannt: Der Lkw-Hersteller wird demnach künftig Fahrzeugteile nach Algerien liefern, wo sie in einem Werk in Rouiba montiert werden sollen. Rouiba liegt im Norden Algeriens an der Mittelmeerküste, wenige Kilometer östlich der Hauptstadt Algier. Finanziert wird das neue Werk von Daimler-Großaktionär Aabar Investments aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem algerischen Staat.
Vom Band laufen könnten dort Unimog, Sprinter oder Geländewagen der Mercedes G-Klasse. "Wir nutzen das Wachstumspotenzial, das der algerische Markt für Fahrzeuge aller Art bietet", meinte Daimler-Manager Peter Alexander Trettin dazu. Er ist verantwortlich für den Vertrieb von Mercedes-Benz-Fahrzeugen in den Regionen Zentral- und Osteuropa, Afrika und Asien. Daimler exportiert dabei nicht nur fertige Bausätze sondern auch grundlegende Teile der deutschen Berufsausbildung nach Nordafrika. "In Abstimmung mit dem algerischen Staat und Aabar", wie es heißt, wird am Standort Algier/Rouiba nach deutschem Vorbild ein duales Ausbildungssystem eingeführt. Die Jugendarbeitslosigkeit in Algerien ist hoch: Zetsche könnte indirekt dazu beitragen, die sozialen Spannungen in dem nordafrikanischen Land abzubauen. Neue Arbeitsplätze soll es auch in Deutschland geben. "Unsere Autos sind weltweit so gefragt, dass wir dieses Jahr über 10.000 neue Mitarbeiter einstellen, davon allein 4000 in Deutschland", hatte Zetsche im Februar angekündigt.
Am Gewicht sparen mit Carbon
Daimler will den Spritverbrauch durch ein niedrigeres Gewicht seiner Modelle verringern und hat sich dazu bereits mit dem japanischen Kohlefaserspezialisten Toray zusammengetan. Am Standort Esslingen bei Stuttgart soll ein Gemeinschaftsunternehmen Leichtbauteile herstellen. Das Unternehmen zur Herstellung und Vermarktung von carbonfaserverstärkten Kunststoffen (CFK) sollte eigentlich noch im ersten Quartal gegründet werden. Die Serienfertigung sollte früheren Angaben zufolge 2012 starten.
Hintergrund sind neue Regeln aus Brüssel: Die Autobauer müssen im nächsten Jahr schärfere Abgasvorschriften der EU einhalten. Deshalb arbeiten alle Hersteller fieberhaft an der Entwicklung von alternativen Antrieben. Weil die Einführung von abgasfreien E-Autos noch dauert, suchen die Hersteller nach Auswegen. Eine Möglichkeit: Leichte Autos sind leichter zu beschleunigen. Dadurch verbrauchen sie weniger Sprit. Eine Gewichtsreduzierung ist mittlerweile auch wichtig, da Autos immer mehr Technik für Sicherheit und Komfort enthalten, wodurch sich das Gewicht erhöht. Durch die Batterien von Hybridautos, die einen Elektromotor mit einem herkömmlichen Verbrennungsaggregat verbinden, nimmt das Fahrzeuggewicht gewaltig zu.
Kohlefaserbauteile haben zudem den Vorteil, dass sie dem Fahrzeug eine höhere Steifigkeit verleihen als herkömmliche Blechteile. Außerdem sind sie weitaus weniger anfällig: Sie rosten nicht. Europas größter Autokonzern Volkswagen war Anfang März überraschend bei dem Kohlefaser-Spezialisten SGL Carbon eingestiegen. Die Konkurrenz ist Daimler-Chef Zetsche dicht auf den Fersen.
Quelle: ntv.de, mit AFP/DJ/dpa/rts