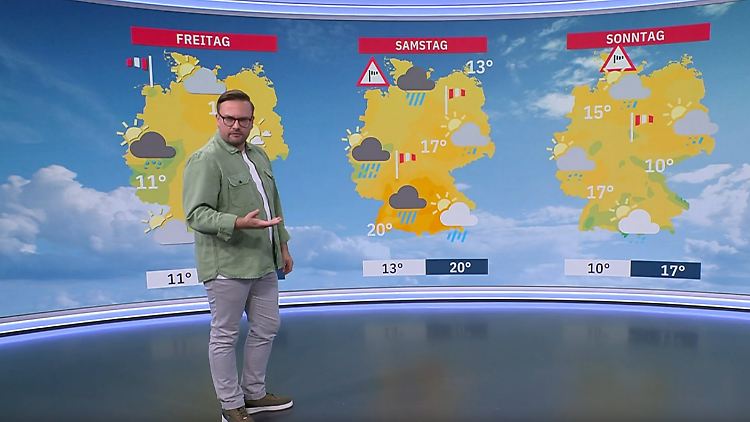Fragen und Antworten Der Sandsack - Helfer in der Not
12.06.2013, 13:05 Uhr
Die Solidarität in den Flutgebieten ist riesig: Wer helfen kann, hilft.
(Foto: dpa)
Geschaufelt, abgebunden, zugebunden, zugeworfen und gestapelt: Der Sandsack ist das wichtigste Handwerkszeug gegen die Wassermassen. Mit ihnen schützen Helfer die Häuser gegen die Fluten oder stützen Deiche ab. Aber woher kommen Sand und Sack? Und wo landen sie wenn sie ihren Dienst getan haben?
Egal ob in Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Bayern oder anderen betroffenen Gebieten, überall kämpfen Soldaten, Feuerwehrleute und tausende Freiwillige mit den Fluten - ihr wichtigstes Handwerkszeug: der Sandsack. Man kann mit ihnen neue Sandsackdeiche bauen, vorhandene Deiche erhöhen oder Gebäude schützen.
Wie sieht ein optimaler Sandsack aus?
Der Grundsatz "Viel hilft viel" gilt hier nicht. Prall gefüllte Sandsäcke sind zu steif und können sich in ihrer Form nicht an darunter liegende Sandsäcke anpassen. So entstehen Lücken im Deich. Ein guter Sandsack ist nur zu rund zwei Dritteln gefüllt. Dann wiegt er zwischen 15 und 20 Kilogramm. Sonst lässt sich das obere Ende nicht mehr umschlagen oder zuschnüren. Zum Einsatz kommen Jute- und Plastiksäcke. Die Jutesäcke sind im Deichschutz vernünftiger einsetzbar, weil sie rutschfester sind und weil sie nach Gebrauch am Deich bleiben und verrotten können. Kunststoffsandsäcke sind dafür beständiger gegen Nässe, Fäulnisbildung, bergen aber ein erhöhtes Verletzungsrisiko in sich.
Wie können Jute- oder Plastiksäcke helfen, wo befestigte Deiche versagen?
Einer der Gründe ist ihre Flexibilität, da sich die Sandsäcke zum einen gut an den Untergrund anpassen können, aber auch dank ihrer Maße im Vergleich zu größeren Barrieren leicht transportieren lassen. "Bei einem Übertritt oder wenn Wasser längere Zeit am Deich steht, wird der Deichkern ausgespült. Damit verliert der ganze Deich an Stabilität", sagt Thomas Tjäden vom Technischen Hilfswerk. "Eine sogenannte Deichfuß-Sicherung mit gezieltem Abstützen der betroffenen Stellen durch Sandsäcke bringt dann zusätzliche Stabilität. Das hilft in etwa 95 Prozent der Fälle." Dabei werden die Sandsäcke so am Fuß des Deichs gestapelt, dass das Wasser noch gezielt abfließen kann.
Woher kommen Sand und Sack?
Der Sand kommt gewöhnlich aus Kiesgruben des eigenen Ortes, die Säcke von Konzernen hierzulande, die in Asien, aber auch in der Türkei oder Italien produzieren lassen. Leer kosten sie dann bis 25 Cent, gefüllt ab 1,30 Euro.
Wie kommt der Sand in den Sack?
Es gibt spezielle Sandsackfüllanlagen. Die großen Anlagen kosten zwischen 10.000 und 15.000 Euro und werden deshalb selten angeschafft, berichtet Sandsack-Unternehmer Stefan Seidel n-tv. Schneller geht es aber, wenn direkt vor Ort abgefüllt wird und zudem günstiger wenn es per Hand geschieht.
Deutschland gehen die Sandsäcke aus. Was tun?
Bislang konnte der Engpass mit Hilfe der EU-Nachbarstaaten überwunden werden. Insgesamt wurden bereits 1,65 Millionen leere Sandsäcke aus dem Ausland geliefert. Nach einer Aufstellung des Bundesinnenministeriums kamen 500.000 Sandsäcke aus den Niederlanden, 150.000 aus Luxemburg, 200.000 aus Belgien und 804.000 aus Dänemark. Sollte weiterer Bedarf bestehen, soll eventuell noch in Polen angefragt werden. "Das gemeinsame Lagezentrum entscheidet, ob der Bedarf aus dem Inland gedeckt werden kann oder aus dem Ausland hinzugekauft werden muss", heißt es aus dem Bundesinnenministerium.
Woher können Hausbesitzer Säcke und Sand bekommen?
Normalerweise sind ungefüllte Sandsäcke in Baumärkten und teilweise im Baustoffhandel erhältlich. Jutesäcke sind Experten zufolge am stabilsten und halten lange. Plaste kann schnell reißen und rutschen, Vlies nur einmalig verwendet werden. Kosten für einen Jutesack: Weniger als ein Euro. Für 100 Stück sind zirka 1,5 Tonnen Sand nötig. Hier ist auf die Korngröße zu achten, die zwischen zwei und sechs Millimeter liegen sollte. Dazu zählt beispielsweise Bausand. Bei anderen Größen besteht die Gefahr, dass das Gemisch durchs Gewebe dringt oder Hohlräume entstehen. Sand und Säcke müssen stets trocken gelagert werden.
Wie werden die Sandsäcke entsorgt?
Jutesäcke können nach Gebrauch am Deich bleiben und dort verrotten. Kunststoffsäcke dagegen bedeuten auch nach der Flut noch Arbeit. Die Plastiktüten müssen aufgeschnitten und entsorgt werden. Der Sand kann vielerorts bleiben und wird zum Beispiel ansässigen Baufirmen überlassen. Organisiert wird die Entsorgung der Plastik-Sandsäcke durch die Katastrophenschutzbehörden in Zusammenarbeit mit Abfallämtern der Landkreise und Gemeinden. Die Sandsäcke werden eingesammelt. Dann wird geprüft, ob die Säcke weiterverwendet werden können. Was nass ist, geht auf die Deponie. Wenn möglich, gehen weiterverwendbare Sandsäcke an die Besitzer zurück.
Aber auch andere Möglichkeiten der Entsorgung sind denkbar, wie eine Aktion in Dresden zeigt. Dort, wo das Wasser Schaden angerichtet hat, sollen die Jutesäcke ein zweites Mal helfen. Die gebrauchten Säcke sollen gesäubert und zusammengenäht zu Tragetaschen mit dem Aufdruck "AllesJuteDresden" verarbeitet werden und so Spendengelder generieren. Verkaufspreis: 8,76 Euro. Der maximale Hochwasserpegel lag in Dresden bei 8,76 Meter.
Gibt es keine Alternative zu den Sandsäcken?
Zu den bewährten Sandsäcken könnte es künftig auch eine technologische Alternative geben. Die sogenannten Floodsax-Kissen funktionieren im Prinzip wie eine Babywindel. Sie saugen sich voll Wasser und wachsen dann zur vollen Größe an. Leer wiegen sie nach Angaben des Herstellers 200 Gramm, mit Wasser dann bis zu 25 Kilo. Die wasserabsorbierende Innenpads bestehen aus einer Mischung von geflocktem Zellstoff und einem selbstaktivierenden Polymer. Der Hersteller verspricht, dass die Hightech-Säcke das Wasser bis zu drei Monaten speichern können.
Quelle: ntv.de