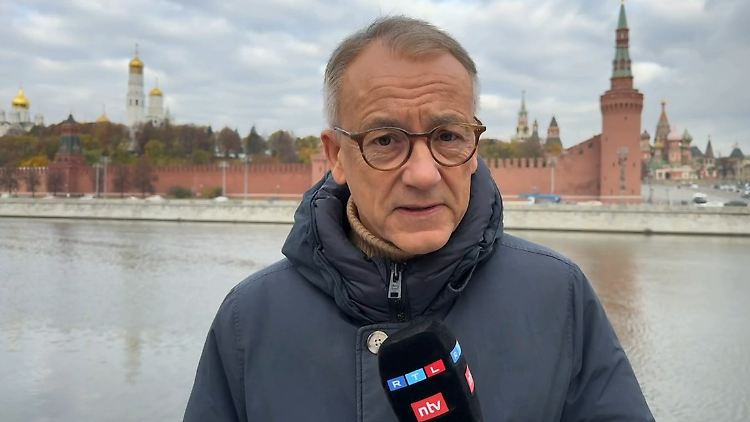Nach dem Gipfel ist vorm Gipfel Lösung birgt neue Probleme
27.10.2011, 13:01 Uhr
Zum Kampf bereit steht die Europa in den Herrenhäuser Gärten in Hannover.
(Foto: picture alliance / dpa)
Die Eurofighterin war müde. In einer spektakulären Nachtsitzung rang Angela Merkel an der Seite von Frankreichs Präsident Sarkozy und Eurogruppenchef Juncker mit den Banken um die Rettung des Euros. Doch die Kanzlerin weiß, dass der Befreiungsschlag noch nicht gelungen ist.
Übernächtigt und erschöpft sah die deutsche Bundeskanzlerin aus, als sie am frühen Donnerstagmorgen den Journalisten die Ergebnisse des Euro-Gipfels erläuterte. Was Angela Merkel in ihrem typischen Duktus dozierte, erweckte den Eindruck, sie hätte eine dröge Arbeitssitzung ohne besondere Vorkommnisse hinter sich. "Wir haben die Probleme (…) wieder einen Schritt weit einer Lösung zugeführt", blinzelte die CDU-Politikerin in die Kameras.
Die Journalisten wussten natürlich, was hinter den Kulissen abgelaufen war. In den Stunden zuvor hatten sie die Drähte in die Redaktionen heiß laufen lassen. Ohne den Hinweis auf "dramatische Stunden in Brüssel" kam kaum ein Bericht aus. Der Höhepunkt: Merkel, der französische Präsident Nicolas Sarkozy und Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker rissen die Gespräche mit den Vertretern der Banken über den Schuldenschnitt für Griechenland persönlich an sich. "Wir haben nur ein einziges Angebot gemacht", gab Merkel einen Einblick in ihre Verhandlungsführung: "Das war unser letztes Wort." In die Rolle der knallharten Eurofighterin wollte sie dennoch nicht schlüpfen. "Ich habe immer wieder gesagt, 'Es gibt nicht den einen Paukenschlag'". Dieser Satz verrät nicht nur etwas über Merkels Stil, sondern vor allem etwas über die Ergebnisse des Gipfels.
Schuldenschnitt mit Schleifchen
In den nächtlichen Sitzungen wurden die Banken zur Zustimmung zum Schuldenschnitt für Griechenland gedrängt – "freiwillig", wie die Vertreter der Privatgläubiger im Nachgang betonten, verzichten sie auf 50 Prozent der Verbindlichkeiten. Ob sie die Vereinbarung auch einhalten, lässt diese Erklärung offen. Brüssel beabsichtigt, dass Griechenlands Schulden über einen im Januar beginnenden Anleihetausch um 100 Milliarden Euro sinken. Der Euro-Rettungsfonds EFSF soll den betroffenen Banken, Fonds oder Versicherungen eine Absicherung von 30 Milliarden Euro gewähren – konkret bedeutet das: kommt es zu Ausfällen in der Kredittilgung, haftet die europäischen Steuerzahler bis zu dieser Summe. Die zweite Maßnahme für Griechenland: Athen erhält vom EFSF ein zweites Kreditpaket von 100 Milliarden Euro bis 2014.
Die EU schätzt, dass der Schuldenstand Griechenlands bis 2020 auf 120 Prozent des Bruttoinlandsproduktes sinken kann. Dann könnte das Land wieder an den Kapitalmarkt zurückkehren. Allerdings müssen die privaten Gläubiger dann beim geplanten Anleihetausch mitspielen. Außerdem, so gab Merkel selbst zu, basieren die Zahlen auf Annahmen der Troika – neue Hiobsbotschaften aus Athen könnten den Plan also schnell zu einem Fall für den Papierkorb werden lassen.
Sorgen um griechische Banken
Um die Folgen des Schuldenschnittes für die Banken abzufedern, müssen sich die Geldhäuser einen Risikopuffer zulegen. Bis Mitte 2013 müssen sie ihre Kernkapitalquote auf neun Prozent erhöhen. Insgesamt veranschlagen die Experten einen Kapitalbedarf von 106 Milliarden Euro. Die deutschen Banken müssen zusätzlich 5,2 Milliarden Euro beschaffen.
Wie das gehen soll, zeigt das Beispiel Commerzbank. Finanzvorstand Eric Strutz sagte, die Bank wolle die benötigten knapp drei Milliarden Euro unter anderem durch den Verkauf von Finanzanlagen im Nicht-Kernbereich oder von nichtstrategischen Geschäftsfeldern sicherstellen. Zudem könnten mögliche Gewinne einbehalten werden. Neben der Commerzbank erfüllen auch die Deutsche Bank, die NordLB und die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) die geforderten Kapitalquoten nicht.
Während die deutschen Banken die Rekapitalisierung nach Meinung von Experten wohl aus eigener Kraft schaffen dürften, bereiten die Finanzhäuser anderer Länder Sorgen. Die europäische Bankenaufsicht (EBA) schätzt, dass griechische Banken 30 Milliarden Euro benötigen. Spanischen Instituten fehlen demnach 26,16 Milliarden Euro, italienischen Banken 14,77 Milliarden Euro. Die Geldhäuser sollen bis Ende des Jahres mit ihren nationalen Aufsichtsbehörden Kontakt aufnehmen und Vorschläge machen, wie sie die Auflagen erfüllen wollen. Bis zum Erreichen der Ziele sollen sie Boni und Dividenden zurückhalten. Wenn alle Maßnahmen nicht ausreichen, sollen die nationalen Regierungen einspringen – da allerdings in den Haushalten von Griechenland, Italien und Spanien kaum Geld zu holen sein dürfte, dient der EFSF als letzter Ausweg.
Die Risiko-"Bazooka"
Auf den Rettungsfonds stützen sich die größten Hoffnungen. Die Billionen-"Bazooka", wie der EFSF martialisch getauft wurde, bildet das Kernstück der "Firewall", die die Staats- und Regierungschefs um den Euro herum errichten wollen. Die Zahlen sind beeindruckend: 250 bis 275 Milliarden Euro stehen als Basis bereit, über den vieldiskutierten "Hebel" stemmt der Fonds damit eine Summe von rund einer Billion Euro.
Der Mechanismus setzt beim Kauf von Staatsanleihen in Bedrängnis geratener Euro-Länder an. Das Zauberwort heißt Versicherung: Investoren sollen geködert werden mit dem Angebot, dass der EFSF im Falle einer Pleite beispielsweise 25 Prozent ihrer Verluste übernimmt. Nach dieser Rechnung würde der Fonds etwa nicht für 100 Euro selber Anleihen kaufen, sondern vier Investoren dazu bringen, jeweils eine Anleihe für 100 Euro zu kaufen.
Doch der Hebel ist letztlich ein Feldversuch am lebenden Objekt, die Risiken kaum überschaubar, wie Angela Merkel selbst einräumen musste: "Es ist sehr schwer - ohne die Instrumenten jemals angewendet zu haben – schon sagen zu können, was das dann wirklich bedeutet." Die Regierungen glaubten, so die Kanzlerin, mit dem Hebel Flexibilität gewonnen zu haben. Kritiker warnen vor dem erhöhten Risiko. Schließlich verwandelt sich der EFSF von einer Vollkaskoversicherung, die mit 440 Milliarden für Staatsanleihen garantiert, zu einer Teilkaskoversicherung: Bei einem Gesamtvolumen von einer Billion Euro erhöht sich die deutsche Haftungssumme von 211 Milliarden Euro zwar nicht. Tatsächlich steigt aber das Risiko, dass es zu einem Ausfall kommt. Zumal sich die Haftungssumme indirekt erhöhen könnte: Wenn die Banken etwa wegen hoher Abschreibungen Verluste machen, müsste über mögliche fällige Rettungspakete der Steuerzahler einspringen - kein unbekanntes Phänomen.
Chaos in Rom
Um Staatspleiten zu verhindern und die ökonomische Lage der Länder der Euro-Zone zu stabilisieren, sieht die Abschlusserklärung des Brüsseler Gipfels die Stärkung des Stabilisierungsrahmens vor. Im Klartext bedeutet dies die Festschreibung der Schuldenbremse in den nationalen Verfassungen – ein Schritt, den Merkel und Sarkozy bereits im August gefordert hatten.
Ergänzend nimmt die EU ihre Sorgenkinder an die Kandare. Spanien und Italien haben Reformen angekündigt. Besonders Italien bereitet Brüssel Sorgen – gerät die drittstärkste Wirtschaftskraft der Euro-Zone in Bedrängnis, können die Staats- und Regierungschefs ihren Terminkalender für den nächsten Krisengipfel freimachen. Merkel wertete es deswegen als "besonders wichtig", dass Rom sich verpflichtet, den Schuldenstand bis 2014 auf 113 Prozent des BIP zu senken. 2013 will Silvio Berlusconi einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen – wenn er denn zu diesem Zeitpunkt noch Ministerpräsident ist. Die Gerüchte über einen Rücktritt des Cavaliere zum Jahresende wurden zwar entschieden dementiert, über die ebenfalls geplante Einführung der Rente mit 67 zeichnen sich jedoch unüberbrückbare Differnenzen mit Berlusconi Bündnispartnern von der Lega Nord ab. Kurz: Wie es in Rom weitergeht, weiß niemand. In italienischen Medien wird selbst über eine Übergangsregierung nach einem Rücktritt Berlusconis spekuliert: Eine schlingernde Volkswirtschaft ohne reguläre Regierung: ein Horrorszenario für Brüssel.
Zunächst haben die Märkte und die Politik grundlegend positiv auf die Gipfelbeschlüsse reagiert. Doch der "vieldimensionale Ansatz", den Merkel den Journalisten präsentierte, birgt weitere Unsicherheiten. Die Eurofighter haben mit dem Löschen begonnen. Sie müssen hoffen, dass die Glutnester sich nicht zu neuen Flächenbränden auswachsen.
Quelle: ntv.de, mit dpa/AFP