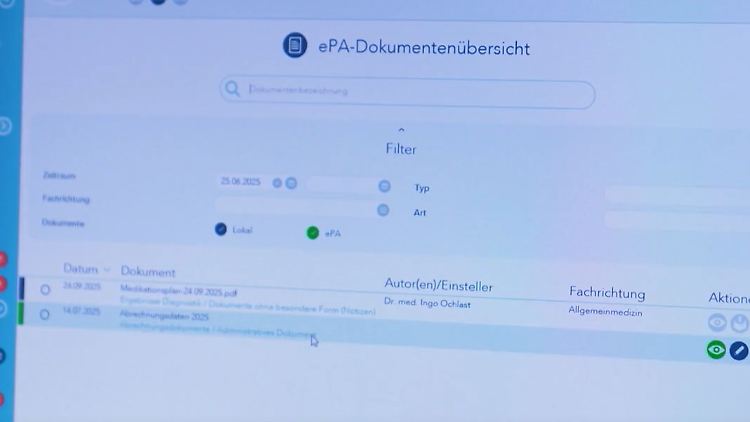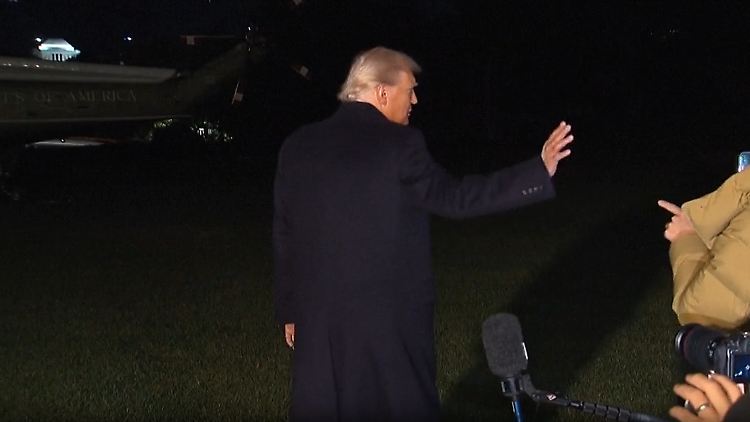Greenpeace lobt Kanzlerin Merkel schließt die Hintertür
03.06.2011, 16:44 Uhr
Bundeskanzlerin Merkel und NRW-Ministerpräsidentin Kraft (l.) verkünden die Einigung.
(Foto: dapd)
Beim Treffen mit den Ministerpräsidenten der Länder erfüllt Kanzlerin Merkel die Hauptforderung der Opposition: Die Abschaltung der 9 letzten AKW in Deutschland soll nicht auf einen Schlag erfolgen, sondern nach und nach. Selbst Greenpeace spricht von einem Fortschritt. Eine Einigung gibt es auch bei der Förderung von Windstrom. Die "Südschiene" funktioniert wieder.
Die 17 Atomkraftwerke in Deutschland sollen nun doch wie von SPD und Grünen gefordert stufenweise abgeschaltet werden und nicht innerhalb weniger Monate in den Jahren 2021 und 2022. Jedem AKW werde ein Ausstiegsdatum zugeordnet, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach einem Gespräch mit den Ministerpräsidenten. Die CDU-Chefin betonte, die Koalition wolle "nicht gegen die versammelte Meinung der Länder agieren".
Nach Merkels Angaben besteht nun Klarheit über den Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens bis Anfang Juli. Am 17. Juni soll der Bundestag mit seinen Beratungen beginnen, die Abstimmung im Parlament ist für 30. Juni geplant. Abschließend beraten soll der Bundesrat am 8. Juli.

Grüner wird's nicht: Kanzlerin Merkel kommt in Begleitung von Kraft und Sachsen-Anhalts Regierungschef Haseloff zur Pressekonferenz.
(Foto: dapd)
Am Abend stimmten die Spitzen von Union und FDP diesen Verfahren zu. Das bayerische AKW Grafenrheinfeld soll 2015 wahrscheinlich als erstes der 9 letzten Kernkraftwerke vom Netz gehen. Weitere Abschaltungen von je einem AKW sind 2017 und 2019 geplant, gefolgt von drei weiteren 2021 und den letzten drei Anlagen 2022.
"Das ist ein Fortschritt"
Die Umweltschutzorganisation Greenpeace reagierte mit einem ausdrücklichen Lob: "Merkel hat sich dem öffentlichen Druck gebeugt und die Atom-Mogelpackung zurückgezogen", sagte Atomexperte Tobias Münchmeyer. Nun wolle sie endlich einen echten Ausstiegsplan vorlegen. "Das ist ein Fortschritt. Auch die Abschaltung von sieben Alt-Reaktoren und Krümmel sind ein wichtiger Schritt." Greenpeace bekräftigte gleichwohl, dass ein Atomausstieg bis 2022 zu langsam sei. Nötig sei ein Ausstieg bis 2015.
Auch die Grünen begrüßten die geplante schrittweise Abschaltung der verbleibenden neun Atomkraftwerke. Nun komme es darauf an, wie die einzelnen Abschaltstufen konkret aussehen sollen, sagte Grünen-Fraktionsvize Bärbel Höhn. "Wir Grüne werden die neuen Vorschläge der Bundesregierung genau prüfen, sobald die Gesetzesdetails feststehen." Die Grünen wollen gegebenenfalls am 25. Juni bei einem Sonderparteitag über ein Ja oder Nein zu dem Atomausstieg abstimmen.
In einem ersten Entwurf für die Änderung des Atomgesetzes sollten die Betriebsgenehmigungen für die noch laufenden Meiler erst 2021 und 2022 enden. Die Opposition sowie Umweltorganisationen und das Öko-Institut hatten kritisiert, dass so der Übergang zu abrupt gestaltet werde und von möglichen "Tricksereien" gesprochen. Unstrittig ist, dass die derzeit abgeschalteten sieben ältesten Meiler und der Pannenreaktor Krümmel nicht mehr ans Netz gehen sollen.
Schwarz-Gelb besteht auf Kaltreserve

Man versteht sich: Kanzlerin Merkel, Finanzminister Schäuble und Ministerpräsident Kretschmann.
(Foto: dpa)
Die umstrittene sogenannte Kaltreserve, wonach ein AKW für den Fall von Stromengpässen vorgehalten werden soll, wird zunächst trotz der Bedenken der Länder bleiben. Allerdings sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), Merkel habe ausdrücklich erklärt, wenn es technisch möglich sei, solle diese Kaltreserve konventionell über Kohle oder Gas sichergestellt werden.
Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft sagte, es gebe die Möglichkeit zu einem "breiten parteipolitischen Konsens" über den Ausstieg aus der Atomkraft. Entscheidend sei, dass der Prozess unumkehrbar angelegt werde und es keine Hintertüren gebe, sagte die SPD-Politikerin nach dem Treffen der Länderregierungschefs mit Merkel.
Länder stehen zusammen
Haseloff betonte die Einigkeit der Länder unabhängig von ihren jeweiligen Koalitionen. "Wir haben uns 16 zu null auf wesentliche Punkte des Vorgehens auch im Bundesratsverfahren verständigt. Es ist ganz wichtig, dass wir 16 Länder zusammenbleiben."
Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte: "Wenn die Bundesregierung den Ländern folgt, könnte das ein sehr tragfähiger gesellschaftlicher Kompromiss sein, der auch allen Investoren in alternative Energien Investitionssicherheit gibt."
Allerdings müsse die Förderung für die Gebäudesanierung aufgestockt werden, sagte Kraft. "Wir brauchen mehr Geld für die Sanierung bestehender Gebäude." Gerade in diesem Bereich seien immense Arbeitsmarkteffekte zu erwarten. Die Regierung will das bisher erfolgreiche Programm zur Gebäudesanierung um fast eine auf 1,5 Milliarden Euro aufstocken. Aus Sicht der SPD reicht das aber noch nicht aus.
"Die Südschiene funktioniert"
Einig geworden sind Bund und Länder auch bei der künftigen Förderung von Windstrom. Demnach soll es die von der Regierung zunächst geplante Kürzung für Windkraft an Land nicht geben. Die Länder hatten eine zu starke Konzentration auf Windparks in Nord- und Ostsee kritisiert. Hier soll die Förderung wie gehabt um zwei auf mindestens 15 Cent pro Kilowattstunde Strom steigen.
Besonders Baden-Württemberg und Bayern, die bei dem Ausbau der Windenergie erheblichen Nachholbedarf haben, hatten sich für gute Förderbedingungen für Windkraft an Land stark gemacht. "Die Südschiene hat da voll funktioniert zwischen Bayern und Baden-Württemberg", sagte Kretschmann über die Zusammenarbeit mit seinem bayerischen Kollegen Horst Seehofer. Der CSU-Chef hatte die traditionell enge Zusammenarbeit mit dem Nachbarbundesland nach der Wahl in Baden-Württemberg zunächst aufgekündigt.
Quelle: ntv.de, hvo/AFP/dpa