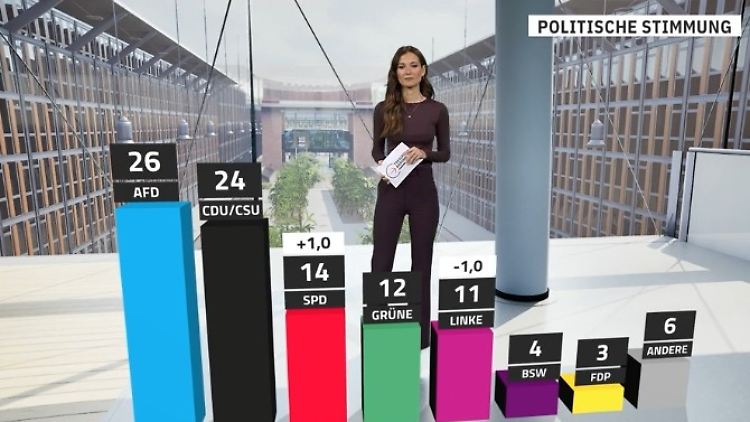Der Widerstand der EU-Staaten Merkels "Planwirtschaft" scheitert
18.12.2013, 13:33 Uhr
(Foto: AP)
Seit Jahren versucht Kanzlerin Merkel, die Euro-Mitgliedsstaaten zu Wirtschaftsreformen zu verpflichten. Auf dem EU-Gipfel will sie einen neuen Anlauf wagen. Verbitterung macht sich breit.
Für Angela Merkel ist das Thema eine Last, die sie nicht los wird. "Zum wiederholten Male", sagt sie und erhebt bei diesen drei Worten ihre Stimme, "Zum wiederholten Male" werde sie am Donnerstag und Freitag auf dem EU-Gipfel in Brüssel mit den Regierungschefs der Mitgliedsstaaten über verbindliche Wirtschaftsreformen sprechen. Es sind die einzigen Worte, bei denen Merkel bei ihrer ersten Regierungserklärung nach der Wiederwahl auffällig moduliert. Eine gewisse Verbitterung ist der Kanzlerin anzumerken.
2011 versuchte Merkel erstmals, die Mitgliedsstaaten zu Strukturmaßnahmen zu zwingen. Sie warb für einen "Pakt für Wettbewerbsfähigkeit", der die großen Unterschiede bei den Euro-Ländern in der Lohn-, Steuer- und Haushaltspolitik angleichen sollte. Sie scheiterte. Kaum ein Jahr später, wagte sie es erneut. Sie setzte darauf, dass vor allem die Krisenstaaten in Europa Verträge mit der europäischen Union schließen und sich darin zu Reformen verpflichten. Sie scheiterte wieder. Die Aussicht, dass Merkel auf diesem EU-Gipfel daran etwas ändern kann, ist gering. Sie muss trotzdem wieder dafür werben. Denn ihrer Meinung nach sind verpflichtende Wirtschaftsreformen ein entscheidender Punkt, um sicherzustellen, dass sich die Euro-Krise nicht wiederholen kann.
"Bilaterale Knebelverträge"
Bisher verpflichtet der Stabilitäts- und Wachstumspakt die Mitgliedsstaaten, eine Reihe von wirtschaftlichen Indikatoren einzuhalten. Dazu gehört, dass sie ihr jährliches Haushaltsdefizit auf drei Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes begrenzen müssen. Verbindliche Vorgaben, wie sie mit strukturellen Missständen wie aufgeblasenen Behörden oder maßlosen Beamtengehältern umzugehen haben, gibt es derzeit nur für die Staaten, die schon unter den europäischen Rettungsschirm geschlüpft sind. Das will Merkel ändern. Der Kanzlerin geht es darum, sicherzustellen, dass Staaten künftig gar nicht erst hilfsbedürftig werden.
Wenn keine Verbindlichkeit bestehe, werden die Indikatoren weiter nur auf dem Papier stehen, sagt Merkel und mahnt: Die Krise sei noch nicht überwunden. "Wir müssen durch Vorsorgepolitik die Ursachen beseitigen, die zu dieser Situation geführt haben." Die Kanzlerin widmet diesem Punkt einen besonders üppigen Teil ihrer Regierungserklärung. Dabei stehen weitere große Themen auf der Tagesordnung des EU-Gipfels: die Bankenunion, die Staat und Steuerzahler davor schützen soll, marode Geldhäuser retten zu müssen und die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU.
Nur Sekunden nach ihrem Auftritt bekommt die Kanzlerin zu spüren, dass sie die Widerstände gegen ihre Pläne mit ihren Worten nicht brechen konnte. Sahra Wagenknecht nennt verbindliche Absprachen zu Strukturreformen "bilaterale Knebelverträge". Es gehe darum, die Parlamente der anderen Mitgliedsstaaten zu entmachten, so die stellvertretende Fraktionschefin der Linken.
Mit Lohnkürzungen gewinnt man keine Wahlen
Die Mini-Opposition im Bundestag - Grüne und Linke haben nur noch 127 von 631 Sitzen - können Merkel zwar kaum stoppen, doch das brauchen sie auch nicht. Der ernstzunehmende Widerstand kommt aus den EU-Mitgliedsstaaten. Deren Regierungschefs haben in den Verhandlungen in den vergangenen drei Jahren Merkels "Pakt für Wettbewerbsfähigkeit" in eine Wortblase mit dem Namen "Partnerschaft für Wachstum, Jobs und Wettbewerbsfähigkeit" verwandelt. Der Entwurf der Schlusserklärung des EU-Gipfeltreffens strotzt vor verschachtelten Sätzen. Inhaltlich ist festzuhalten: Entscheiden sich die Mitgliedsstaaten für diesen Entwurf, und danach sieht es aus, wird es auch in Zukunft keine verbindlichen Strukturmaßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit im Sinne Merkels geben. Allein ein Anreiz könnte etwas verändern. Der Entwurf sieht Zuwendungen für die Staaten vor, die sich tatsächlich zu Strukturreformen verpflichten. Details dazu wollen die Regierungschefs beim EU-Gipfel im Sommer 2014 festzurren.
An den Argumenten der Gegner verpflichtender Wirtschaftsreformen wird sich bis dahin aber wohl wenig ändern. Sie werfen Merkel eine europäische "Planwirtschaft" vor, den Versuch, den anderen Staaten ein deutsches System überzustülpen. Das wiegt schwer. Entscheidend für das Scheitern von Merkels Vorhaben könnte aber noch etwas anderes sein: Den angeschlagenen Regierungschefs Europas dürfte es ausgesprochen schwerfallen, vor ihre Wähler zu treten und Entlassungen, Lohnkürzungen und Subventionsabbau zu fordern.
Quelle: ntv.de