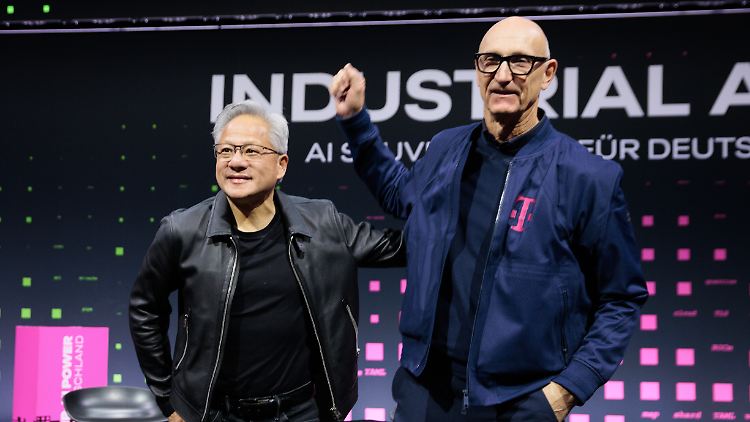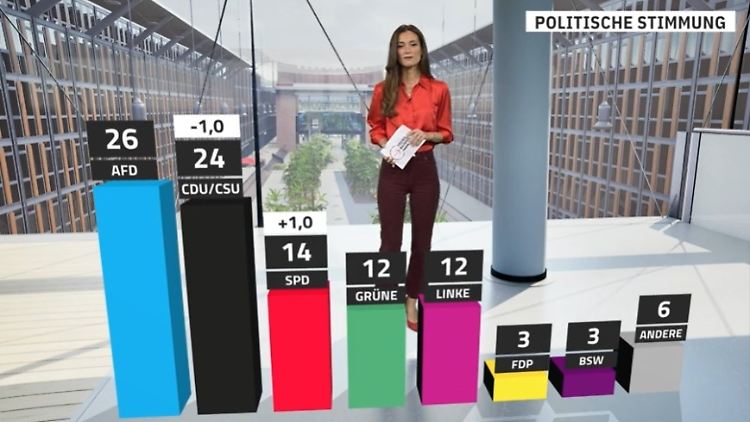Top-Spion wird rausgeworfen Deutschland gewöhnt sich ab, devot zu sein
10.07.2014, 17:05 Uhr
In Deutschland fühlten sich die US-Geheimdienste über Jahrzehnte wie zuhause. Das soll vorbei sein.
(Foto: imago/Christian Ohde)
Auch wenn die USA sich weigern, es zu begreifen: Im deutsch-amerikanischen Verhältnis muss sich einiges ändern. Und, Überraschung: Es ändert sich schon. Zumindest langsam.
Hoppla! Das hätte man der Bundesregierung gar nicht zugetraut. Sie weist den CIA-Statthalter in Berlin, den sogenannten Residenten des US-Geheimdienstes, aus Deutschland aus. Damit hat die Bundesregierung ein Exempel statuiert. Das ist richtig und überfällig.
Die Ausweisung eines Botschaftsmitarbeiters - und ein solcher ist der CIA-Resident - ist ein ungewöhnlich deutliches Signal in der symbolischen Kommunikation der internationalen Diplomatie. Es wäre auch möglich gewesen, hinter den Kulissen eine Abberufung des Spions zu erreichen. Das hätte der Tradition des Vertuschens entsprochen, mit der die Bundesregierung offenbar brechen will.
Und nun? Noch immer ist es völlig undenkbar, dass Deutschland den früheren NSA-Mitarbeiter Edward Snowden ins Land holt, hier befragt und dann vor einem Zugriff durch US-Geheimdienste schützt. Das hat politische und historische Gründe: Auch nach dem Ende des Kalten Kriegs sind die USA der wichtigste Verbündete der Bundesrepublik. Den will man nicht verärgern.
Umgekehrt sehen die USA ganz offensichtlich noch immer auf Deutschland herab: Bis 1990 war die Bundesrepublik nur eingeschränkt souverän, US-Geheimdienste hatten hierzulande Sonderrechte, die aus der Besatzungszeit stammten und in geheimen Abkommen festgeschrieben waren. Heute wissen wir, dass sich daran auch nach der Wiedervereinigung nicht viel änderte: Die Bundesregierung blieb duckmäuserisch und akzeptierte beispielsweise, dass die USA ihre Drohnenkriege in Afrika von Deutschland aus führen.
Doch Deutschland gewöhnt sich gerade ab, devot zu sein. Dass die Bundesregierung die Spionageabwehr auf die amerikanischen Nachrichtendienste ausweitet, zeichnet sich bereits ab. Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen plädiert seit Wochen für eine "starke Spionageabwehr". Er denkt dabei nicht nur an Staaten wie China und Russland: Die Snowden-Dokumente hätten gezeigt, sagte er bei einem Symposium des Verfassungsschutzes Anfang Mai, dass Spionageabwehr wichtig sei, wenn man die freiheitlichen Grundrechte schützen wolle.
Neben einer verstärkten Spionageabwehr wären Sanktionen auf politischer Ebene denkbar. Im vergangenen Herbst hatte die damalige Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner gefordert, die TTIP-Verhandlungen auszusetzen, bis die Vorwürfe gegen die NSA geklärt seien. Die CSU-Politikerin wurde damals schnell zurückgepfiffen. Mittlerweile hat sich die Stimmung jedoch gedreht, mittlerweile ist vorstellbar, was noch vor wenigen Monaten absurd erschien.
Noch ist nicht klar, ob die Bundesregierung den Mut zu mehr als einer symbolischen Eskalation hat. Wird Deutschland die Rechte seiner Bürger selbstbewusst verteidigen? Oder wird es seinen eigenen Geheimdienstapparat nur aufblähen, um im Spiel der Großen mitzumischen? Wird das deutsch-amerikanische Verhältnis am Ende ausgewogener sein? Oder werden die USA sich von diesem lästigen Europa abwenden, das sich nicht kontrollieren lassen will? Letzteres wäre alles andere als wünschenswert. Sicher ist aber: So wie es ist, kann es nicht bleiben.
Quelle: ntv.de