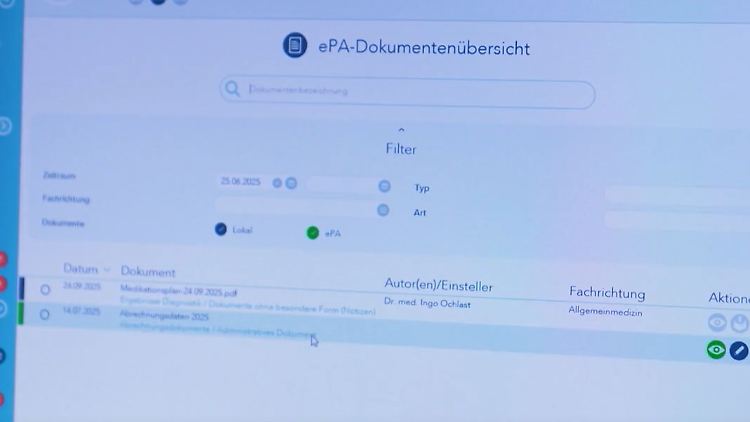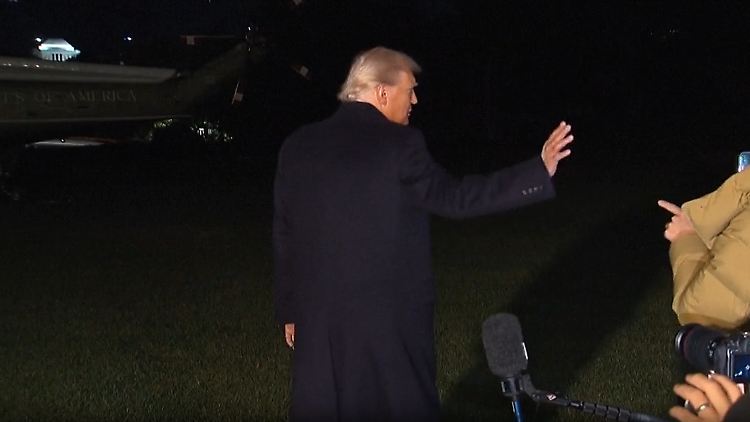Geldspritze der Notenbanken "All das wird dauerhaft nicht gutgehen"
30.11.2011, 20:55 UhrAngesichts der ungelösten Schuldenkrise nehmen die Spannungen im europäischen Bankensystem weiter zu. Das Misstrauen der Geldinstitute untereinander wächst - erkennbar daran, dass sie immer mehr Geld bei der EZB parken, statt es sich gegenseitig zu leihen. Jetzt gehen die wichtigsten Notenbanken der Welt überraschend in die Offensive. Sie greifen in einer abgestimmten Aktion am Geldmarkt ein. Ziel: Mehr flüssige Mittel für das weltweite Finanzsystem bereitzustellen, um Finanzierungsengpässe bei Banken und damit auch bei Unternehmen zu verhindern. Während die Börsen die Aktion mit kräftig steigenden Kursen feiern, bleibt der Jubel der deutschen Presse verhalten. Für sie ist die Eurokrise mit der Finanzspritze noch lange nicht beendet.

Die EZB und die Notenbanken von Kanada, den USA, Japan, der Schweiz und Großbritannien fluten die Märkte mit Geld.
(Foto: picture-alliance/ dpa)
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) erläutert die Umstände der gemeinsamen Offensive der wichtigen Notenbanken der westlichen Welt: "Die Zentralbanken sichern den Geschäftsbanken zu günstigen Bedingungen schnellen und problemlosen Zugriff zu den wichtigsten Währungen der Welt. Das Bankensystem ist derzeit durch tiefes Misstrauen gekennzeichnet. Mit ihren Eingriffen wollen die Zentralbanken aber nicht nur dessen Funktionsfähigkeit verbessern, sondern auch zur Stützung der lahmenden Konjunktur beitragen. Die Steuerung der Konjunktur gehört zwar aus guten Gründen nicht zum offiziellen Aufgabenkatalog der EZB, wird in der Praxis aber von vielen Zentralbanken als eine Art Nebenaufgabe betrachtet, sofern sie nicht dem Ziel eines stabilen Geldwertes entgegensteht".
Dass die Euphorie, die die konzentrierte Aktion der fünf wichtigsten Notenbanken an den Börsen ausgelöst hat, lange anhält, ist für die Märkische Allgemeine "eher unwahrscheinlich". "Doch angesichts der Ratlosigkeit, die auf den Rängen der Politik derzeit herrscht, bleibt den Währungshütern nichts anderes übrig, als zu handeln. In der Hoffnung, Schlimmeres zu verhindern, solange sich die Regierungsveranwortlichen der Euro-Länder nicht klar darüber sind, wo es lang gehen soll". Für die Kommentatoren aus Potsdam ist die Situation schlichtweg "fatal": "Während Merkel, Sarkozy & Co darüber streiten, welche Rolle die Europäische Zentralbank künftig spielen soll - ob Inflationswachhund oder Konjunkturstimulator, ob es Eurobonds geben soll oder nicht - wird in der Chefetage im Frankfurter Euro-Turm entschieden, was zu tun ist".
"So sollten Maßnahmen gegen die Euro-Krise aussehen: abgestimmt und offensiv", lobt die Landeszeitung den "Befreiungsschlag der wichtigsten Notenbanken der Welt". Nach Ansicht der Kommentatoren aus Lüneburg verhindert die Aktion, "dass sich der Misstrauenseffekt nach der Lehman-Pleite wiederholt, als die Realwirtschaft gelähmt wurde, weil sich Banken untereinander kein Geld mehr liehen und gegenüber Kreditnehmern knauserten". "Allerdings", so heißt es weiter, "löst das Fluten der Märkte mit Geld nur das Liquiditätsproblem, das Solvenzproblem bleibt. Und anders als 2008 droht nicht Banken die Zahlungsunfähigkeit, sondern Euro-Volkswirtschaften. Höchste Zeit also für ein ähnlich kräftiges Signal der Politik, dass das Projekt Europa mit allen Mitteln verteidigt wird. Zeit genug auch für die Kanzlerin, ihr striktes Nein in Sachen Eurobonds und Schuldenaufkauf durch die EZB in ein Ja umzumünzen".
Dass die Notenbanken mit ihrem koordinierten Vorstoß, den Banken mehr Geld zur Verfügung zu stellen, "nur die Probleme im europäischen Bankensystem lösen" ist auch die Ansicht der Pforzheimer Zeitung. Nach wie vor ungelöst bleibe "die Euro-Krise selbst, denn diese trifft die hoch verschuldeten Staaten. Auf dieses Problem ist die Politik bislang eine Antwort schuldig geblieben". Und so fordern die Kommentatoren des baden-württembergischen Blattes: "Egal ob Rettungsschirme mit und ohne Hebel, Euro-Bonds oder 'Elite'-Anleihen - Hauptsache die Staats- und Regierungschefs finden endlich zu einer gemeinsamen Linie. Die Zentralbanken haben vorgemacht, wie es geht. Jetzt ist die Politik am Zug".
Wenig überzeugt vom gemeinsamen Schritt der Zentralbanken zur Stützung der Finanzmärkte gibt sich der Münchner Merkur: "Riesige Geldspritzen für die taumelnden Märkte sind Verzweiflungstaten: Die Europäische Zentralbank versucht, die Krise des Vertrauens in den Fortbestand des Euro mit Geld zuzuschütten. Obendrein soll sie noch Ramschanleihen der Pleitestaaten ankaufen". Das Blatt aus Bayern ist überzeugt: "All das wird dauerhaft nicht gutgehen, weil es die Inflation weiter anheizt". Zudem werde "das wichtigste Kapital des Euro zerstört: das Vertrauen der Bürger in seine Wertbeständigkeit". Schon jetzt sei die EZB "mit ihrer lockeren Geldpolitik" kaum noch in der Lage, ihr Versprechen stabiler Preise einzuhalten. "Dass zugleich immer mehr Anleger aus Angst vor der Entwertung ihres Ersparten in Immobilien flüchten, ist ein weiteres Warnsignal: Die Inflationserwartungen verfestigen sich, die Teuerung verselbständigt sich".
Quelle: ntv.de, zusammengestellt von Susanne Niedorf-Schipke