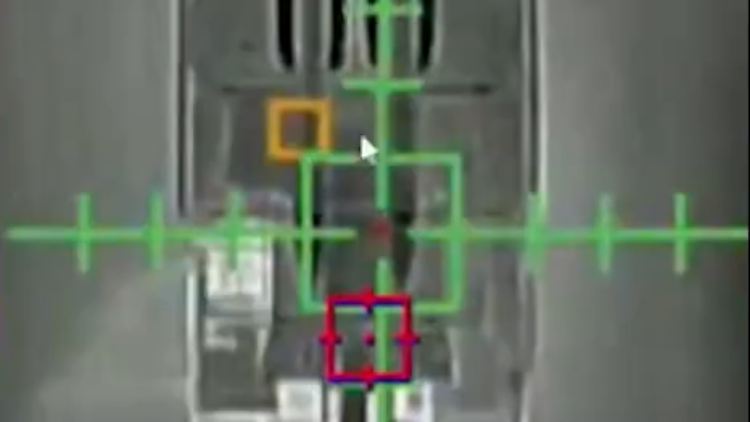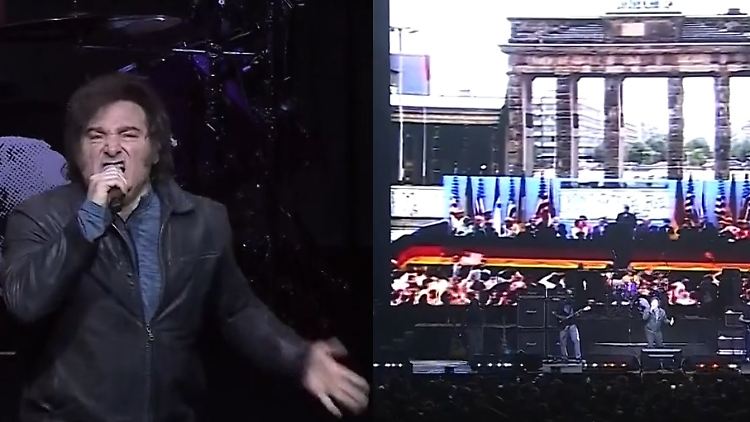Niedersachsen & Bremen NS-Gedenkstätte geschändet – Täter bekommt Bewährungsstrafe
09.10.2025, 14:24 Uhr
(Foto: Tim Schaarschmidt / Hannoversche)
Maschinenpistole zu Hause, Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus zerstört und eine rechtsextreme Vergangenheit – der Angeklagte hat einiges auf dem Kerbholz. Wie tritt er vor Gericht auf?
Hannover (dpa/lni) - Ein früherer Neonazi, der Kränze in der NS-Gedenkstätte Hannover-Ahlem geschändet hat, ist vom Amtsgericht Hannover zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Der 26-Jährige erhielt damit das höchstmögliche Strafmaß, das noch zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Der Richter sprach von einer Tat, die das Gedenken an Millionen Opfer des Nationalsozialismus "mit Füßen getreten" habe.
Das Gericht sprach den nach eigenen Angaben ehemaligen Rechtsextremisten wegen Sachbeschädigung und Verstößen gegen das Waffengesetz schuldig. Die Staatsanwältin hatte ein Jahr und zehn Monate auf Bewährung gefordert, die Verteidigung eine Bewährungsstrafe "im Ermessen des Gerichtes".
Der 26-Jährige muss laut Urteil zudem 2.000 Euro an ein Programm gegen Radikalisierung zahlen und selbst verpflichtend an einem Aussteigerprogramm für Rechtsextremisten teilnehmen. Seine Bewährungszeit beträgt drei Jahre. Er trägt auch die Kosten des Verfahrens.
Vollautomatische Maschinenpistole, Munition, ein Springmesser
Der Mann hatte Ende Januar mehrere zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus niedergelegte Kränze in der Gedenkstätte umgeworfen und beschädigt. So entstand ein Sachschaden von 700 Euro. Das Gericht stellte eine politische Motivation der Tat fest. Bei einer späteren Durchsuchung wurden beim Täter eine vollautomatische Maschinenpistole, Munition, ein Springmesser sowie weitere Waffen gefunden ‒ trotz eines richterlichen Verbots, Waffen zu besitzen.
Trotz des unerlaubten Waffenarsenals sah das Gericht beim Angeklagten keine Umsturzgedanken gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung. Anderenfalls wäre er laut Richter "weit weg" von einer Bewährungsstrafe gelandet und würde "sicher nicht als freier Mann nach Hause gehen".
Angeklagter gesteht die Tat
Der Angeklagte hatte zuvor vollumfänglich gestanden. "Ich bereue die Tat in jeder Hinsicht", sagte er. Die Verteidigung akzeptierte das Urteil und verzichtete darauf, Rechtsmittel einzulegen.
"Sie haben sich dazu entschlossen, das Gedenken an Millionen toter Menschen buchstäblich mit Füßen zu treten", sagte der Richter in seiner Urteilsverkündung. Der Angeklagte habe die Opfer des Nationalsozialismus mit der Tat herabgewürdigt und verhöhnt. Laut Staatsanwältin hat er "Opfer und Angehörige verächtlich gemacht".
Zu seinen Lasten legte ihm das Gericht besonders die rassistische Motivation der Tat in der NS-Gedenkstätte. Zudem hatte der Angeklagte bereits zuvor in einem anderen Gerichtsprozess bekundet, sich von der rechten Ideologie distanzieren zu wollen ‒ vor der Tat an der NS-Gedenkstätte.
Täter war bei "Jungen Nationalisten" aktiv ‒ dann Wechsel zur AfD
Der Angeklagte hatte sich schon während seiner Schulzeit radikalisiert und war mindestens seit 2018 in der rechtsextremen Szene aktiv. Auf Plattformen im Internet hatte er unter anderem Juden als Ungeziefer bezeichnet. Der ehemalige Neonazi war länger im Umfeld der "Jungen Nationalisten" aktiv ‒ die Jugendorganisation der neonazistischen Partei "Die Heimat" (früher NPD). Von dieser habe er sich später gelöst und sei zur AfD gewechselt, sagte er.
Zugunsten des Angeklagten wertete das Gericht dessen Geständnis, erkennbare Reue und eine glaubhafte Distanzierung von ehemaligen "Kameraden" und der rechtsextremen Ideologie. Der Angeklagte habe etwa aus eigenem Antrieb ein Aussteigerprogramm gesucht und in einem Brief an die Gedenkstätte um Entschuldigung gebeten. Darin bat er um eine Gelegenheit, Reue zu zeigen ‒ etwa Geld zu spenden oder Sozialarbeit in der Gedenkstätte zu verrichten. Das Gericht erteilte ihm angesichts seiner Verlobung zudem eine positive Sozialprognose.
Tatverdächtiger schon häufiger rechtsextrem aufgefallen
Der Täter wollte demnach mit seinem Angriff auf die NS-Gedenkstätte gegen einen angeblichen "Schuldkult" vorgehen. Mit diesem abwertenden Begriff bezeichnen Rechtsextremisten die angeblich übertriebene, ritualisierte oder dauerhafte Auseinandersetzung Deutschlands mit dem Nationalsozialismus.
Auch habe er die angegebenen Opferzahlen des Zweiten Weltkriegs in Geschichtsbüchern als "übertrieben" angesehen. Juden habe er als schwach empfunden, weil sie keine "Krieger" seien und lange Zeit keinen eigenen Staat gehabt hätten. Von diesem Gedankengut distanzierte er sich im Prozess. Er habe die Schrecken des Zweiten Weltkriegs ausgeblendet und zum Zeitpunkt der Tat kein Mitleid mit den Opfern des Nationalsozialismus gehabt.
Angeklagter bereitete sich mit Waffen auf "Tag X" vor
Zentral war im Gerichtsprozess auch der sogenannte "Tag X". In der rechtsextremen Ideologie bezeichnet "Tag X" den ersehnten Zeitpunkt eines gewaltsamen Umsturzes oder Zusammenbruchs des bestehenden Staates, nach dem die Extremisten ihre eigene autoritäre Ordnung errichten wollen.
Die gehorteten Waffen habe der Täter für diesen Tag beschafft, um sich und seine Familie zu verteidigen. Er habe zwar durch Verschwörungserzählungen von "Hetzern" im Internet an diesen nahenden Tag geglaubt, ihn aber nicht herbeigesehnt, sondern sich vielmehr vor der erwarteten Anarchie gefürchtet. Den "Tag X" habe er sich "wie eine Art Zombie-Apokalypse" vorgestellt. Vor allem die Isolation der Corona-Pandemie habe diese Gedanken verstärkt.
Täter will ein "unbescholtener Bürger" werden
Im Prozess nannte der Angeklagte seine ehemaligen Kameraden "Versager". Die rechtsextreme Ideologie sei "weltfremd" und wolle "nur Schaden anrichten". Er habe heute kein Problem mehr mit Menschen mit Migrationshintergrund und sehe eine Verantwortung vor der Geschichte. Es sei wichtig, regelmäßig zu erinnern, "damit sich so etwas nicht wiederholt".
"Ich habe realisiert, wie schwer man sich verbrennen kann", sagt der 26-Jährige über seine rechtsextreme Vergangenheit. Er habe keinen Grund mehr, "zu den Rechten zurückzugehen". Er wolle nur als "unbescholtener Bürger" mit seiner Verlobten eine Familie gründen.
Quelle: dpa