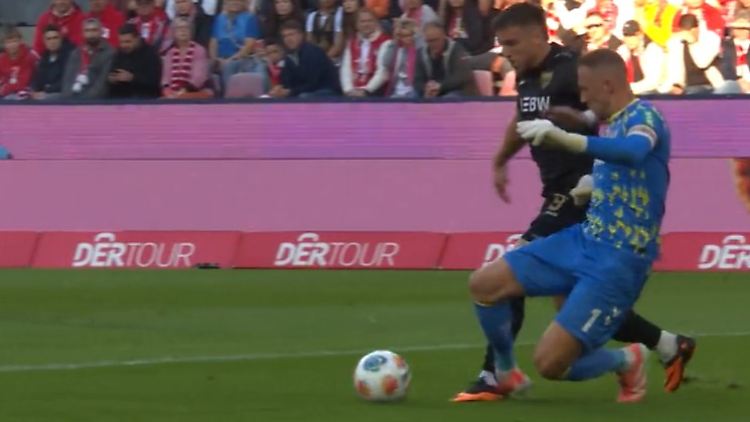Per WM in ein neues Leben? Obdachlose kicken, der König schaut zu
12.09.2015, 08:22 Uhr
Eine Szene aus dem Finale Afghanistan gegen Russland der Obdachlosen-WM in Australien.
(Foto: picture-alliance/ dpa)
Die Welt zu Gast in Amsterdam: Für die Fußball-Weltmeisterschaft der Obdachlosen reisen Team aus 49 Nationen in die Niederlande und kämpfen um den Titel. Das Projekt gibt es schon mehrere Jahre und bedeutet für die Teilnehmer viel mehr als nur sportlichen Erfolg.
Kein Geringerer als König Willem-Alexander eröffnet an diesem Samstag die Obdachlosen-WM im Fußball auf dem Museumsplatz vor dem weltberühmten Rijksmuseum in Amsterdam. Das niederländische Staatsoberhaupt schaut sich dann auch das Eröffnungsspiel der Oranje-Damen gegen Argentinien und das Duell der heimischen Männermannschaft gegen Nordirland an.
Für die 13. Auflage der Weltmeisterschaft melden die Organisatoren 49 Nationen, 16 Frauen- und 48 Männerteams. Deutschland reist allerdings ohne Frauen an. 2014 bei den Titelkämpfen in Chile gewann bei den Frauen Mexiko, bei den Männern das Gastgeberland, Deutschland kam auf Rang 18. Platzierungen sind für die Teilnehmer aber nicht das Allerwichtigste, die Teilnahme ist für viele schon ein Sieg. Namen berühmter Stars fehlen. Sie dürften auch, wenn sie wollten, gar nicht mitspielen, höchstens den Kickoff vornehmen, denn sie haben ein Dach über den Kopf und zählen nicht zur Zielgruppe.
"Kickoff" hat bei den obdachlosen Straßenfußballern mehr als eine sportliche Bedeutung. Viele von ihnen sind nicht nur wohnungslos, sondern auch vorbestraft. Sie waren drogen- und/oder alkoholsüchtig. Sie überleben als Straßenzeitungsverkäufer und haben einen Wunsch: die Reintegration in die Gesellschaft. Maximal zwei Sportler pro Team mögen auch Flüchtlinge oder Asylbewerber sein. Darum heißt der WM-Song auch "Life can't kick me down".
Homeless Worldcup bringt Ordnung ins Leben
Weltweit sind mehr als 100 Millionen Menschen obdachlos. Diese Situation findet der Schotte Mel Young, Mitbegründer und Vorsitzender des Verbandes der internationalen Straßenzeitungen (INSP), der die Titelkämpfe organisiert, unerträglich. So entstand 2001 die Idee, einen Homeless Worldcup einzuführen. 2003 fand die erfolgreiche Premiere in Graz (Österreich) statt. 100.000 Menschen nehmen jährlich an Streetfootball-Projekten der INSP teil. Straßenfußball ist für viele von ihnen die Möglichkeit, ihr Leben wieder in Ordnung zu bringen. Er hilft ihnen Freundschaften zu schließen und macht sie körperlich und geistig wieder fit.
Als Anerkennung ihrer Arbeit empfinden die Amsterdamer Organisatoren den Besuch des Königs. "Der Besuch des Königs gibt an, dass der Sport für diese leicht verletzbare Gruppe seriös genommen wird. Wir fühlen uns sehr geehrt", sagt Turnierdirektor Arne de Groote. Untersuchungen haben ergeben, dass 80 Prozent der Teilnehmer nach einem Turnier ihr Leben besser in den Griff bekamen. Sie waren nicht mehr drogensüchtig, bezogen eine feste Wohnung. Sie erhielten einen Ausbildung- oder gar einen festen Arbeitsplatz. Einige wurden ehrenamtliche Helfer bei einem Fußballklub.
Ein Spieler darf nur einmal an der WM teilnehmen, meistens das Erlebnis seines Lebens. Auch die Spielregeln sind anders als beim Profifußball. Ein Team besteht aus acht Aktiven, einem Torwart, drei Feldspielern und vier Einwechselspielern. Die Spieldauer beträgt 14 Minuten (zweimal sieben Minuten). Das Spielfeld ist 22 mal 16 Meter groß. Das Projekt beeindruckte die Vereinten Nationen und die Europäische Fußball-Union so, dass sie es seit Jahren finanziell unterstützen.
Quelle: ntv.de, Christiana Mansfeld, sid