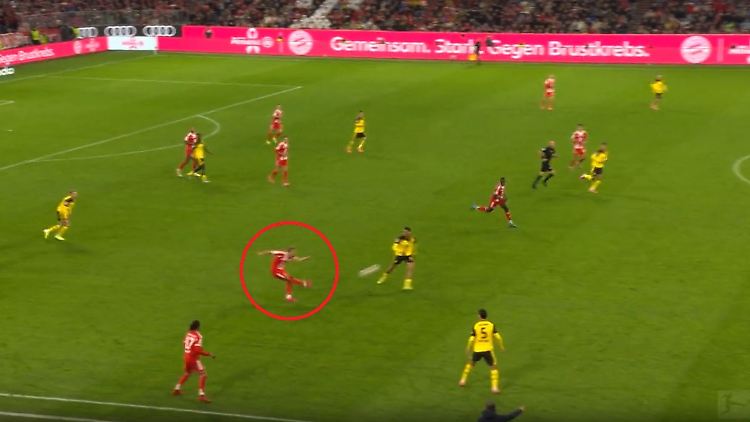Einer gegen alle Wie Bosman den Fußball veränderte
15.12.2015, 13:54 Uhr
Jean-Marc Bosman (m.) und zwei seiner Anwälte, Marc Lucan (l.) und Jean-Claude Dupont.
(Foto: dpa)
Jean-Marc Bosman wollte nur Fußball spielen und sorgte, mehr oder minder gewollt, für eine Revolution des Weltfußballs. Sein Feldzug gegen das Transfersystem brachte ihm mehr Feinde als Freunde. Heute jährt sich das wegweisende EuGH-Urteil zum 20. Mal.
In der Geschichte des modernen Fußballs markiert der 15. Dezember 1995 einen Wendepunkt historischen Ausmaßes. Durch das sogenannte Bosman-Urteil erschütterte der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg das System in seinen Grundfesten. Die höchstrichterliche Entscheidung mit dem Aktenzeichen RS C-415/93 besiegelte das Ende von Ablösesummen nach Ablauf von Verträgen und darüber hinaus auch von bis dahin gängigen Ausländerbeschränkungen. Die Luxemburger Richter stellten quasi über Nacht die Machtverhältnisse zugunsten der Spieler auf den Kopf.
Der EuGH-Beschluss nach einer Klage des bis dahin weitgehend unbekannten Profi-Kickers Jean-Marc Bosman auf das in den EU-Verträgen verankerte Recht zur freien Wahl seines Arbeitsplatzes ließ von einem auf den anderen Tag eine der wichtigsten Geldquellen für die Vereine schlichtweg versiegen. Mehr noch: Seit jenem Tag stopfen sich neben absoluten Superstars inzwischen auch noch selbst mittelmäßige Spieler und ihre Berater Millionen und Abermillionen in die eigenen Taschen.
Diese Entwicklung hatte Bosman bei seiner lange Zeit belächelten Klage gar nicht im Sinn. "Es ist paradox", meinte der Belgier dieser Tage in einem Interview mit der italienischen Gazzetta dello Sport: "Der Reichtum sollte unter allen verteilt werden, aber jetzt machen nur einige wenige ganz viel Geld. Die Spieler waren wie Tiere in einem Käfig gefangen, und ich habe sie befreit. Heute aber sind sie Geiseln eines Systems, in dem der Fußball zu einer Maschinerie geworden ist."
"Schlimmste Katastrophe, die der Klubfußball je erlebt hat"
Bosman selbst wollte seinerzeit eigentlich nur spielen (können): Weil 1990 nach Ablauf seines Vertrags beim FC Lüttich Bosmans Wechsel zum französischen Zweitligisten US Dünkirchen an einer zu hohen Ablöseforderung gescheitert war, ließ der Durchschnittsprofi die Rechtmäßigkeit der Transfersummen und die Beschränkung seiner Freizügigkeit im EU-Arbeitsmarkt fünf Jahre lang durch alle Instanzen bis nach Luxemburg überprüfen - und triumphierte über das System.
"Es war die schlimmste Katastrophe, die der Klubfußball je erlebt hat", fasst Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vom deutschen Branchenführer Bayern München die Auswirkungen mit martialischen Worten zusammen.
Eine Katastrophe vielleicht, aber mitnichten der Untergang: Tatsächlich verging zwar einige Zeit bis zur für die Entwicklung neuer Strategien zur Refinanzierung und zur Schulung einheimischen Talente. Doch mittlerweile speisen sich die Klubs hauptsächlich aus milliardenschweren TV-Verträgen, die einzig eine Bezahlung der in astronomische Höhen gestiegenen Spielergehälter noch möglich machen.
In Deutschland setzten Vereine und Verband der nach Bosman eingetretenen Ausländerschwemme - 2001 standen erstmals in der Bundesliga bei Energie Cottbus im Spiel gegen den VfL Wolfsburg elf nicht für die deutsche Nationalelf spielberechtigte Akteure in der Anfangsformation - nachhaltige Ausbildungspläne entgegen: Profi-Klubs müssen Teile ihrer Fernseh-Millionen inzwischen verpflichtend in den Betrieb von Nachwuchs-Internaten statt in neue Spieler investieren, und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) baute sein Stützpunktsystem aus.
Bosman zahlt hohen Preis
Das Kontrastprogramm zum Konzept im Weltmeister-Land liefert Englands Premier League: Die privaten Investoren agieren mit immer neuen Millionen nicht zuletzt auch für die nach Bosman in Mode gekommenen Handgelder für Profis als maßlose Preistreiber auf dem längst völlig überhitzten Markt besonders für ausländische Spieler. Und Bosman selbst? Die Szene machte den "Rebell" zur Persona non grata, seine Profi-Karriere war nach 1995 faktisch beendet. Nur ganz wenige Profis zeigten angesichts seiner Existenzprobleme Solidarität und unterstützten den Wegbereiter ihres neuen Wohlstands mit kleineren Einmal-Spenden.
Bosmans Leben geriet völlig aus der Bahn. Alkoholprobleme, Depressionen und zuletzt sogar eine Haftstrafe - Bosman ist längst der größte Verlierer seines historischen Erfolgs. Dennoch ist der gestürzte Rebell mit sich im Reinen: "Ich hätte nicht erwartet, so viel zu verlieren, wie es mir passiert ist. Aber ich würde alles wieder so machen."
Quelle: ntv.de, Dietmar Kramer, sid