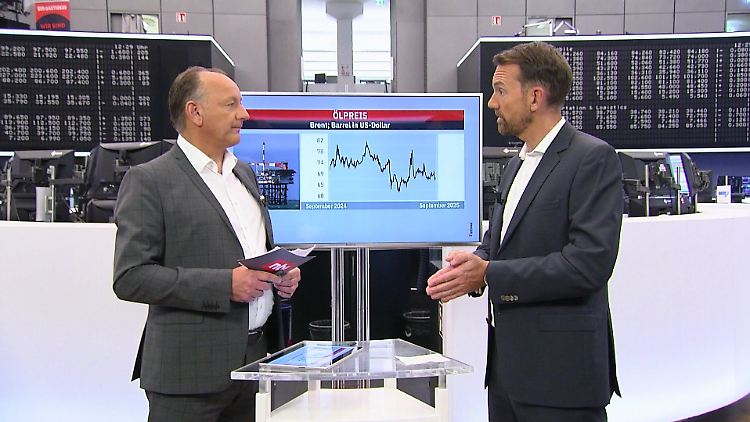CO2-Zertifikate knapper und teurer EU macht beim Emissionshandel ernst
06.05.2015, 16:46 Uhr
Bisher gibt es in Europa Rechte für mehr Abgase, als die Industrie überhaupt ausstoßen will.
(Foto: picture alliance / dpa)
Seit zehn Jahren gibt es den CO2-Emissionshandel in Europa. Doch das System ist ein Flop. Es bietet Unternehmen null Anreiz, ihre Emissionen zu reduzieren. Nach langem Streit einigen sich die EU-Institutionen nun auf eine Reform.
Der derzeit weitgehend wirkungslose Emissionshandel in der Europäischen Union soll ab 2018 reformiert werden. Darauf einigten sich die Ratspräsidentschaft, Europaparlament und EU-Kommission. Mit der Reform sollen Emissionszertifikate für das klimaschädliche Kohlendioxid (CO2) verknappt werden, um die Industrie zu mehr Klimaschutz zu bewegen.
Das neue Emissionshandelssystem (EHS) soll das Flaggschiff der EU-Klimaschutzpolitik werden und dazu beitragen, dass die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 40 Prozent gesenkt werden. Stößt ein Unternehmen in Europa klimaschädliche Abgase aus, muss es dafür seit Beginn des Emissionshandels 2005 Zertifikate vorweisen - Erlaubnisscheine zur Luftverschmutzung und Klimaschädigung.
Gibt es weniger dieser handelbaren Zertifikate, als Unternehmen CO2 ausstoßen möchten, steigt ihr Preis und macht etwa Investitionen in klimafreundliche Technologien als Alternative attraktiver - so die Theorie, die Praxis in Europa ist jedoch anders.
Derzeit sind zu viele Zertifikate auf dem Markt, sodass deren Preise niedrig und damit der Antrieb zu mehr Klimaschutz gering ist. Laut Bundesumweltministerium gibt es über zwei Milliarden überschüssige Zertifikate. Bereits jetzt umgesetzt wird deswegen das sogenannte Backloading, bei dem für die Zeit von 2014 bis 2016 vorgesehene 900 Millionen Zertifikate zurückgehalten werden.
Hendricks lobt Kompromiss
Außerdem sollen ab 2019 etwa 1,5 Milliarden CO2-Rechte in eine Art Ablage geschoben werden, wo sie auf lange Sicht dem Markt entzogen wären. Die EU-Kommission hatte ursprünglich 2021 als Startjahr vorgeschlagen. Nun sollen die Eingriffe zwei Jahre früher beginnen, um den Klimaschutz zu stärken.
Das Startjahr war Knackpunkt in den Verhandlungen auf EU-Parkett: Deutschland war im Sinne des Klimaschutzes für 2017, Polen aus Sorge vor hohen Zusatzkosten für die Industrie für 2021. Mit ihrer Einigung auf das Jahr 2019 wählten die Vertreter des Europaparlaments und der EU-Staaten einen Mittelweg.
Bundesumweltministerin Barbara Hendricks lobte den Kompromiss. "Der europäische Emissionshandel hat wieder eine Zukunft. Das ist eine gute und wichtige Nachricht für den Klimaschutz", sagte Hendricks. Die Reform werde jedoch erst nach 2020 ihre volle Wirkung entfalten. Deshalb sei Deutschland weiter auf zusätzliche nationale Klimaschutzmaßnahmen, "vor allem im Bereich Energieversorgung" angewiesen, betonte sie.
Opposition fordert Komplettausstieg aus Kohle
Damit spielte Hendricks unter anderem auf den Umstrittenen Vorschlag einer Klimaschutzabgabe für ältere Kohlekraftwerke von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel an. Gabriel möchte von älteren Kohlekraftwerken eine Klimaschutzabgabe verlangen, wenn sie einen bestimmten Grenzwert beim CO2-Ausstoß überschreiten.
Die energie- und klimapolitische Sprecherin der Linksfraktion, Eva Bulling-Schröter, begrüßte zwar, dass es schon eine erste Zertifikate-Verknappung im Jahr 2018 geben solle, statt wie von der EU-Kommission vorgeschlagen erst 2021. Trotzdem werde die Maßnahme erst 2019 greifen und damit viel zu langsam. "Statt eines Rumdoktern am Emissionshandel" müsse es einen schrittweisen Ausstieg aus der Kohleenergie geben, forderte sie. Dazu könne Gabriels Vorschlag beitragen.
Quelle: ntv.de, mbo/DJ/dpa