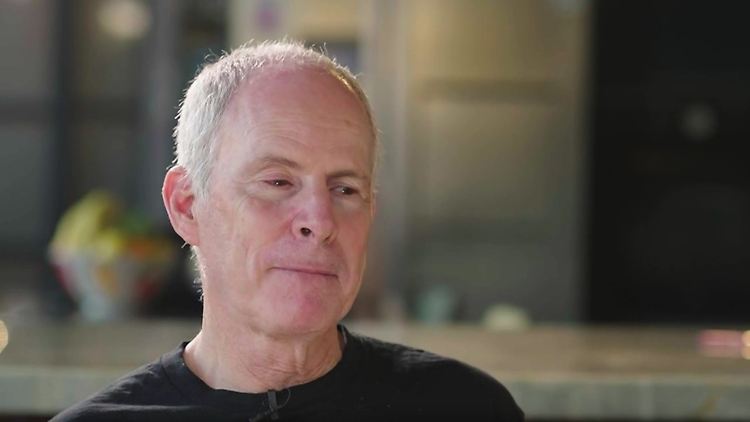Vermögen äußerst ungleich verteilt "Dynamit unter dem Fundament"
18.09.2012, 19:31 Uhr
Nicht wenige Bundesbürger müssen jeden Euro zweimal umdrehen.
(Foto: dapd)
In Deutschland klafft die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Das geht aus dem Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung hervor. Mittlerweile gehören den vermögensstärksten zehn Prozent der Haushalte mehr als die Hälfte des gesamten Nettovermögens. Fatal wird es, betrachtet man die Statistik von der Seite der ärmeren Bevölkerung aus: Diese fünfzig Prozent der Haushalte teilen sich gerade mal ein Prozent des Vermögens. Der Bericht birgt gesellschaftlichen Zündstoff, meint die Presse und betreibt Ursachenforschung.
"Das Auseinanderfallen der Gesellschaft", wie es der Bericht widerspiegele, werde "dieses Land zerreißen", meint der Tagesspiegel aus Berlin, denn "es kann den fundamentalen Konsens zerstören und das parlamentarische System in eine tiefe Krise stürzen." Das Blatt bezieht eindeutig Position: "Wer (…) für Vermögenssteuern und höhere Spitzensteuersätze plädiert, ist kein verkleideter Kommunist. Wer für Mindestlöhne und gegen das Zerschlagen von Vollzeitstellen kämpft, attackiert damit nicht unsere Wirtschaftsordnung. Und wer an Artikel 14 des Grundgesetzes erinnert, in dem Eigentum nicht nur garantiert, sondern auch dessen Sozialbindung angemahnt wird, strebt keine klassenlose Gesellschaft an."
Auch der Münchner Merkur bezeichnet den neuen Armuts- und Reichtumsbericht als "Dynamit unter dem Fundament der Demokratie". Er zeige, "wie die bürgerliche Mitte zerrieben wird zwischen einem wachsenden Heer staatlicher Fürsorgeempfänger und einer immer reicheren Oberschicht. So sehr ist die Kanzlerin mit der Bewältigung der Eurokrise beschäftigt, dass sie die voranschreitende Spaltung der Republik aus dem Blick verloren hat. Statt wie versprochen die kalte Progression zu bekämpfen, hat sich die Koalition auf einen Raubzug in der Mitte begeben. Auch die horrenden Kosten der Eurorettung, von der Energiewende ganz zu schweigen, bürden CDU, CSU und FDP in Form einer anziehenden Teuerung einseitig den Normalverdienern auf, statt auch die Reichen mehr zur Kasse zu bitten." Das Fazit der Zeitung ist eindeutig: "So kann es nicht weitergehen."
Dass eine Lösung her muss, finden auch die Nürnberger Nachrichten, denn "Geld wäre genügend da, um Arme, Kranke, Rentner und Kinder angemessen und sogar ohne große Einschnitte für Wohlhabende zu versorgen." Allerdings müsste sich die Politik darum bemühen, ein Gesetz zu schaffen, das den Reichtum in der Republik "einigermaßen gerecht auf alle Bürger verteilt und ihn nicht im oberen Zehntel der Gesellschaft konzentriert. Doch die dafür nötigen Mehrheiten gab es in den vergangenen beiden Jahrzehnten im Bundestag nie." Vielmehr sei das Gegenteil der Fall: "Der vielleicht wichtigste Gedanke des Sozialstaates, Chancengleichheit über die Umverteilung von Oben nach Unten herzustellen, ist den meisten der relativ gut verdienenden Damen und Herren im Parlament inzwischen ziemlich fremd geworden."
Die Hessische/Niedersächsische Allgemeine sucht ebenfalls nach Gründen und macht ein strukturelles Problem der Demokratie aus: "Wenn unsere Parteien und Politiker gewählt werden wollen, müssen sie Einzelinteressen berücksichtigen. Doch deren Summe ergibt kein Gemeinwohl. Der Armuts- und Reichtumsbericht legt nun in wünschenswerter Deutlichkeit dar, was nach jahrzehntelanger Lobbyarbeit und vier Jahren Finanzkrise falsch läuft: Reiche profitieren, die Mittelschicht stagniert, Arme verlieren. Das Geld des Staates reicht kaum mehr für ausreichend gute Schulen, Bäder und Polizei. Die Vermögensabgabe ist nötig. Die demografische Entwicklung wird uns schon bald zu viel einschneidenderen Reformen zwingen. Typisch, dass dies von den meisten als Bedrohung empfunden wird, nicht als Chance."
Die Süddeutsche Zeitung erinnert allerdings auch daran, dass es ein Irrglaube sei, zu denken, "dass Sozialpolitik allein die Aufgabe der Politik ist, und dort vor allem jenes Ressorts, das als 'Bundesministerium für Arbeit und Soziales' die Zuständigkeit dafür im Namen trägt." Sozialpolitik sei auch der Job jedes einzelnen Bürgers. "Wer seine Ausbildung verschläft und wer sich später den Beitrag für eine Gewerkschaft lieber spart - der darf sich nicht wundern, wenn er in seinem Leben über das Minimum nicht hinauskommt. Schlecht bezahlt wird grundsätzlich dort, wo Gewerkschaften mangels Mitgliedern schwach sind. Aufgabe der Politik ist es, das zu organisieren, was der Einzelne nicht organisieren kann."
Quelle: ntv.de