Boom-Industrie oder Sorgenkind? Die Erneuerbaren am Scheideweg
28.05.2010, 19:43 Uhr
(Foto: picture-alliance/ dpa)
Ihren Anhängern gelten die erneuerbaren Energien als Versprechen auf eine grüne Zukunft, ihren Kritikern als unsichere Kostentreiber. Die Bundesregierung steht mit dem neuen Energiekonzept vor einer wichtigen Weichenstellung, die für die aufstrebende Erneuerbare-Energien-Branche im Abseits enden könnte.
Steigerung des Umsatzes im Krisenjahr 2009 von 30,7 Milliarden auf 33,4 Milliarden Euro. Steigerung des Investitionsvolumens um 20 Prozent. Steigerung der Beschäftigungszahlen um 8 Prozent.
Das sind Kennzahlen der Erfolgsgeschichte der Erneuerbaren-Energie-Branche, die inmitten von Hiobsbotschaften aus der krisengeschüttelten deutschen Wirtschaft die Vision vom "Green New Deal" erreichbar scheinen lassen. Der ökologische Umbau der globalen Produktion soll, so die Idee, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: über Wachstum in den grünen Technologien soll Wohlstand gesichert und ganz nebenbei das Klima gerettet werden.
Die zentrale Rolle in dem Konzept kommt den Erneuerbaren Energien zu. 2009 trugen regenerative Energien 10,1 Prozent zum Gesamtenergieverbrauch in Deutschland bei, Tendenz steigend. Mit 300.000 Beschäftigten ist die Branche zum einem der wichtigsten Arbeitgeber aufgestiegen.
Fernziel "regeneratives Zeitalter"
Bundesumweltminister Norbert Röttgen sonnt sich gern im Erfolg der Erneuerbaren. Seine Vorstellung des "regenerativen Zeitalters", in dem durch eine CO2-neutrale Energiegewinnung die Klimaziele erreicht werden können, prägen seine öffentlichen Auftritte. 2050, unterstreicht er in einer Gesprächsrunde im Deutschlandfunk, soll der Hauptanteil der Energieversorgung durch Erneuerbare bestritten werden. Das deckt sich mit den Verpflichtungen, die sich CDU/CSU und FDP im Koalitionsvertrag auferlegten.
Wie Schwarz-Gelb diese Ziele konkret erreichen will, steht in den Sternen. Noch deckt sich Deutschlands Energiebedarf zu 90 Prozent aus fossilen Brennstoffen. Die sind nicht nur endlich und damit teuerungsanfällig, sondern auch klimaschädlich. Über Erneuerbare lässt sich Energie CO2-neutral produzieren, schon heute tragen die regenerativen Energien zur Einsparung von über 100 Millionen Tonnen Treibhausgas-Emissionen in Deutschland bei.
Im Herbst 2010 will die Regierung ein Energiekonzept vorlegen, das laut Koalitionsvertrag "Leitlinien für eine saubere, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung" formulieren soll. Experten sind skeptisch, ob die Rolle der Erneuerbaren wirklich gestärkt werden soll.
Konflikt ist programmiert
"Die Vorarbeiten lassen Zweifel aufkommen", meint Dr. Christian Hey. Der Generalsekretär des Sachverständigenrats für Umweltfragen (SRU), der die Bundesregierung seit 1971 berät, kritisiert vor allem den Gebrauch des "Brückentechnologie"-Begriffes. Eigentlich sollte damit die Zielvorstellung eines Ausbaus der regenerativen Energien verbunden werden, die Diskussion um Laufzeitverlängerungen für Atommeiler kehre diese Logik aber um: "Der Ausbau der erneuerbaren Energien wird zur abhängigen Größe."
In einer Stellungnahme zu technisch-ökonomischen Szenarien zur vollständigen regenerativen Stromversorgung bis 2050 kommt der Sachverständigenrat zu dem Ergebnis, dass dieses Ziel nicht nur möglich, sondern auch bezahlbar ist. Allerdings stehe die Politik hier vor einer wichtigen Pfadentscheidung. Denn der Ausbau der Erneuerbaren, prophezeit die Studie, wird zwangsläufig in einen Konflikt mit konventionellen Energiequellen münden. "Eine deutliche Verlängerung der Laufzeiten von Kernkraftwerken sowie der Neubau von Kohlekraftwerken (…) sind nicht mit dem hier vorgeschlagenen Ausbau der erneuerbaren Energien vereinbar." Problematisch sei vor allem die technische Vereinbarkeit, erklärt Hey: "Atomkraftwerke kann man nicht beliebig flexibel an- und abschalten, wie es der Lastfolgebetrieb für Wind und Sonne in den 2020er Jahren immer häufiger erfordern wird."

Nicht vereinbar: Windkraft und Kohlekraftwerke.
(Foto: picture-alliance/ dpa)
Statt einer Laufzeitdebatte, die zum Investitionsstau in der Off-Shore Windenergie und beim Netzausbau führe, fordert Hey "Richtungs- und Investitionssicherheit". Die rot-grüne Bundesregierung stellte die Richtungssicherheit 2000 durch den Atomkonsens sicher. Ein Kompromiss mit den Energieversorgern, die sich dem von der Regierung beschlossenen Ausstieg aus der Kernenergie beugen mussten. Im selben Jahr verabschiedete der Bundestag das Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien. Die besser als Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) bekannte Regelung garantiert Betreibern, die Strom aus regenerativen Energiequellen in das Stromnetz einspeisen, eine über mehrere Jahre festgelegte Vergütung. Mithilfe dieses Instrumentes stieg der Anteil an Erneuerbaren im Energiemix – das Gesetz erwies sich als so wirkungsvoll, dass mittlerweile über 40 Staaten Förderinstrumente nach dem deutschen Vorbild installiert haben.
Exportschlager made in Germany
Nicht nur das EEG an sich entpuppte sich als Exportschlager, auch Windräder und Sonnenkollektoren made in Germany sind weltweit gefragt. Auf vielen Gebieten üben deutsche Firmen die Technologieführerschaft aus. Großvorhaben wie das Wüstenstrom-Projekt Desertec basieren auf deutschem Know-How.
Wie es um die Innovationskraft der Branche bestellt ist, lässt sich auf den Fachmessen ablesen. Die Intersolar, Leitmesse der Solarindustrie, verzeichnet seit ihrem Bestehen stetig wachsende Aussteller- und Besucherzahlen. Für die diesjährige Auflage vom 9. bis 11. Juni in München erwarten die Veranstalter 1800 Aussteller und 60.000 Besuchern - Zulieferer, Hersteller, Kunden und nicht zuletzt politische Entscheidungsträger.
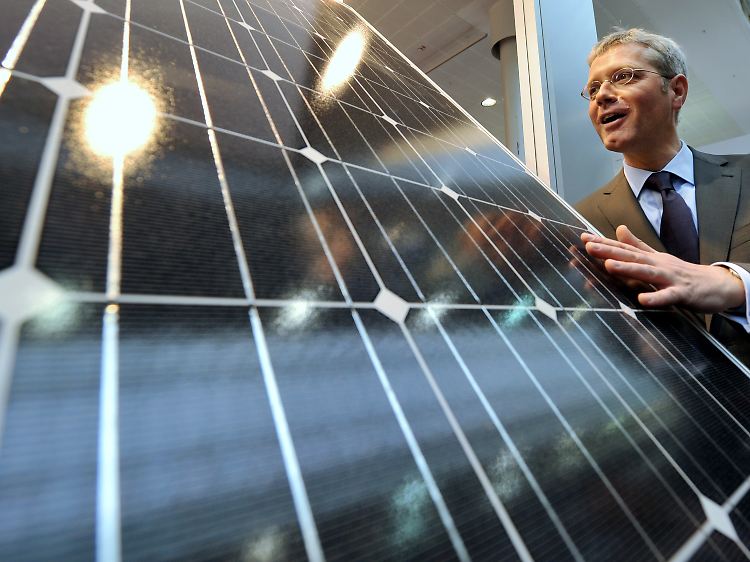
Bundesumweltminister Norbert Röttgen betrachtet auf seinem Rundgang über die Hannover-Messe ein Solar-Modul.
(Foto: picture alliance / dpa)
Denen bescheren Messen normalerweise einen angenehmen Fototermin, doch bei der Intersolar dürfte in diesem Jahr hinter den Kulissen alles andere als eitel Sonnenschein herrschen. Die Bundesregierung hat die Solarförderung gekappt – eine im EEG vorgesehene Maßnahme, die eine Übersubventionierung verhindern soll. Weil die Einspeisevergütung für Solarstrom nach der 9-prozentigen Senkung ab 1. Januar 2010 nun allerdings außerplanmäßig um weitere 16 Prozent gekürzt wird, befindet sich die Branche in Aufruhr.
Die Solar-Unternehmen beklagen einen Alleingang der Regierung, die sich im Koalitionsvertrag eigentlich für eine Senkung nur im Dialog mit den Unternehmen ausgesprochen hatte. Hans-Josef Fell, energiepolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, verurteilt die Senkung der Vergütung im Interview mit n-tv.de als "Überforderung" der Solarindustrie. Arbeitgeber und Arbeitnehmer protestierten im Schulterschluss gegen die Maßnahme, in Jena wurde ein Werk der Schott AG symbolisch geschlossen.
Die Klimakanzlerin unter Zugzwang

Symbolische Schließung: Die Solarbranche protestiert heftig gegen die Kürzung der Einspeisevergütung.
(Foto: picture alliance / dpa)
Schon vor der Kappung wuchs dank des günstigen Produktionsumfeldes der Anteil chinesischer Photovoltaikanlagen am Weltmarkt. Durch die gesunkene Förderung würden deutsche Firmen nun einen gewaltigen Markteinbruch erleiden, prophezeit Fell: "Der Schaden ist bereits da." Neben der Senkung der EEG-Vergütung drückt auch der Haushaltsstopp für das Marktanreizprogramm und andere Programme der Nationalen Klimaschutzinitiative auf die Stimmung. Wegen der angespannten Haushaltslage fließen derzeit keine Fördergelder für den Einbau von von Solarkollektoren oder Wärmepumpen. Für Fell ist die Begründung "nicht haltbar". Jeder Euro, der aus öffentlicher Hand vergeben wird, ziehe ein Mehrfaches an Investitionen und damit Steuereinnahmen nach sich.
Die Folgen blieben nicht auf heimische Gefilde beschränkt, Fell sieht durch die "schlechte Regierungsarbeit" in Sachen erneuerbare Energien die Konkurrenzfähigkeit deutscher Firmen massiv bedroht: "Das hat nichts mit den Herausforderungen einer Exportnation zu tun".
Zwar regt sich aus den Ländern zarter Widerstand gegen die drastische Kappung der Solarförderung, außer einem 100-Millionen-Euro-Programm für die Forschung als Kompensation war der Bundesregierung allerdings noch nichts abzuringen – schon gar nicht ein Machtwort der einstigen Klimakanzlerin. Wie ihre Strategie aussieht, wird sich mit dem Energiekonzept im Herbst zeigen. Wie es scheint, entscheidet sich dann mehr als nur die Zusammensetzung des Energiemixes für die nächsten Jahrzehnte.
Quelle: ntv.de




















