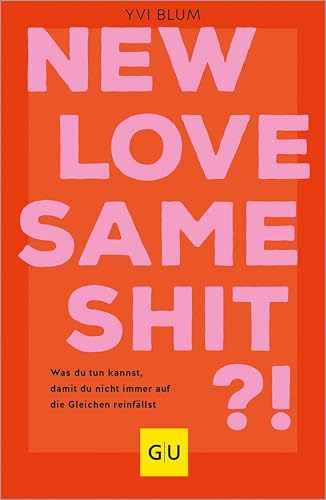Neue Liebe, gleiches ProblemWarum verliebt man sich immer wieder in die Falschen?
 Von Sandra Will
Von Sandra Will
Manche verlieben sich immer wieder in den falschen Menschen - und merken es oft gar nicht. Schuld daran ist vor allem der eigene Bindungsstil, der sich an Altbekanntes klammert, sagt Paartherapeutin Yvi Blum.
Manche Leute geraten immer an denselben Typ Mensch, sei es der Macho, der sich irgendwann nicht mehr meldet oder die Perfektionistin, die ihren Partner verändern will. "Du ziehst diese Leute auf eine magische Weise an", hört man die Freunde sagen, wenn man mal wieder von der gefloppten Situationship erzählt, also von der Kurzzeitaffäre, die sich nicht in eine ernste Partnerschaft entwickelt hat. Dabei steht einem auf Dating-Apps doch eine Vielzahl an Menschen offen, mit denen es eigentlich klappen müsste - tut es aber nicht.
"Durch Social Media und Dating-Apps haben wir die Illusion unendlicher Möglichkeiten, man kann ja sogar TV-Promis eine Nachricht schicken und mit ihnen ins Gespräch kommen. Die tatsächliche Auswahl an Partnern ist aber nicht unbedingt größer", erklärt Paartherapeutin Yvi Blum ntv.de. Sie klärt auf ihrem Instagram-Kanal "Lebenliebeschnaps" über Liebes- und Beziehungsthemen auf. Denn auf der Suche nach dem idealen Partner oder der idealen Partnerin übersieht man die Überzeugungen, die immer wieder zu negativen Erfahrungen führen. "Die einzige Konstante der eigenen Beziehungen ist man selbst. Deshalb sollte man reflektieren, wie man mit Nähe und Distanz umgeht und wie man sich in Konflikten verhält", sagt Blum, der über 90.000 Menschen folgen.
Mithilfe dieser Antworten sei es möglich, sein Bindungsverhalten herauszufinden und zu überdenken. In ihrem neuen Buch "New Love, same Shit?!" zeigt Blum anhand der Bindungstheorie, warum sich manche immer wieder in den falschen Partner verlieben. Grund dafür kann etwa die klassische Verlust- und Bindungsangst sein, die sich auch in der Bindungstheorie wiederfindet. Paartherapeutin Blum weist darauf hin, dass Muster nicht nur durch den Bindungsstil aufrechterhalten werden, sondern auch durch falsche Überzeugungen. "Viele denken, sie müssen nur den Richtigen oder die Richtige finden. Aber der Richtige muss nicht perfekt sein, es muss nicht Liebe auf den ersten Blick sein, mit einem großen Feuerwerk", sagt Blum. Auch wer an der Überzeugung festhält, der Mann müsse den ersten Schritt machen oder man müsse dem Partner im echten Leben zufällig begegnen anstatt auf einer Dating-App zu matchen, steht sich oftmals selbst im Weg.
Bindung wird in der Kindheit geprägt
Die Bindungstheorie basiert auf den Forschungen des britischen Kinderarztes und Psychoanalytikers John Bowlby und der Entwicklungspsychologin Mary Ainsworth, die unabhängig voneinander verschiedene Verhaltensweisen von Kindern festgestellt haben, sollten sie von ihrer Mutter oder einer nahen Bezugsperson getrennt werden. Demnach gibt es drei Kategorien, später kam eine vierte hinzu. Die Psychologen Cindy Hazan und Phillip Shaver stellten später fest, dass das Bindungsverhalten im Erwachsenenalter abhängig ist von der Erfahrung, die man in seiner frühen Kindheit gemacht hat. Laut den Forschern kann sich der Bindungsstil jedoch im Laufe des Lebens auch ändern. Erkennt man also die eigenen Muster, die aufgrund des Bindungsstils entstanden sind und fortbestehen, kann man dies in seinem Datingleben reflektieren und nach Lösungen suchen.
Der erste Bindungstyp ist sicher gebunden und macht etwa die Hälfte der Menschheit aus. Personen mit diesem Stil gehen leicht Beziehungen ein, die langfristig bestehen bleiben. Deshalb sind sie auch nur selten Single und vermutlich nur kurzfristig auf dem "Dating-Markt" zu finden. Sie haben ein gutes Urvertrauen in sich selbst und die Welt um sie herum. Damit fällt es ihnen leicht, Nähe zuzulassen und ihre Bedürfnisse offen zu kommunizieren. Sicher gebundene Menschen scheuen nicht vor emotionaler oder körperlicher Intimität zurück und können in Konflikten konstruktiv nach Lösungen suchen.
Im Gegensatz dazu besteht die andere Hälfte aus unsicher gebundenen Menschen. Sie lassen sich in den ängstlich-klammernden und den vermeidenden Bindungstyp unterteilen. Personen mit dem ängstlichen Stil haben in ihrer Kindheit nur inkonsistent Liebe und Wärme erfahren und sehnen sich in Beziehungen vorrangig nach Nähe und Bestätigung. Bekommen sie diese nicht, zweifeln sie an sich selbst oder werden eifersüchtig. Aus Angst vor Zurückweisung beginnen sie zu klammern. Ängstliche Beziehungstypen sind Menschen, die ihrem Gegenüber im Konfliktfall beispielsweise viele emotionale Nachrichten schicken oder mit Anrufen bombardieren.
Der vermeidende Typ dagegen reagiert auf solche möglichen Nachrichten mit absoluter Distanz und oftmals "Ghosting". In seiner Kindheit wurde er oft abgewiesen und seine Bedürfnisse nicht erhört, deshalb hat er irgendwann die Überzeugung übernommen, allein besser dran zu sein. Vermeider scheuen sich vor Nähe und öffnen sich aus Angst vor Ablehnung oder Verletzung nur selten. Im Konfliktfall zieht sich diese Person zurück, um die eigenen Emotionen besser kontrollieren zu können. Beim Gegenüber kann der Eindruck entstehen, der Streit sei ihm egal.
Die neuere Forschung spricht außerdem von einem vierten "desorientierten" oder "ängstlich-vermeidenden" Beziehungsstil. Personen dieses Typs verhalten sich widersprüchlich gegenüber Bezugspersonen, können ihre Bedürfnisse nicht klar kommunizieren und sind geplagt von tiefen Unsicherheiten und Ängsten. In Konflikten werden sie unsachlich und womöglich auch aggressiv. Diese Bindungsart entsteht durch eine traumatische Vergangenheit, Missbrauch oder Vernachlässigung in der Kindheit und wird oftmals von desorientierten Eltern an ihre Kinder weitergegeben.
Nähe-Distanz-Spiele
Die typischen Verliebtheitsgefühle am Anfang einer Beziehung entstehen vor allem, wenn die eigenen Muster angesprochen werden - und das geschieht oftmals mit unsicher gebundenen Menschen. "Unsicher-vermeidende Menschen sind eher die, die gemischte Signale senden und ein Wechselbad der Gefühle auslösen. An einem Tag setzen sie sehr auf Nähe und am nächsten gehen sie auf Distanz", erklärt Blum.
Unsicher-ängstliche dagegen setzen ihren Partner oft zu schnell unter Druck, indem sie zu viel erwarten oder fordern und ihm nicht den benötigten Rückzug gewähren. Deshalb kommt es auch oft zur Kombination aus klammernd und vermeidend. "Die Beziehung zwischen unsicher-ängstlich und unsicher-vermeidend kann schwierig und sehr herausfordernd sein, weil sie sich magisch anziehen und gegenseitig in ihren Glaubenssätzen bestätigen", sagt Blum. Während der ängstliche Typ versucht, dem Partner möglichst nahe zu sein, zeigt sich beim Vermeider die Angst vor Nähe. Umgekehrt sorgt gerade die Distanz des Vermeiders dafür, dass der ängstliche Part Angst hat, verlassen zu werden - eine Achterbahn der Gefühle entsteht.
Dennoch beschreibt sich Paartherapeutin Blum als Fan dieser Kombination: "Wenn beide gewillt sind, an ihren Mustern und der Beziehung zu arbeiten, kann diese Bindung funktionieren und beide der Heilung näherbringen." Agiert man allerdings weiter wie bisher, findet man sich schnell in einem Teufelskreis aus Rückzug und Verfolgung wieder - und wiederholt diese Kombination womöglich mit vielen anderen Partnern.
Dysfunktionale Beziehungen vermeiden
Blum weist darauf hin, dass die Bindungstypen ein Spektrum abbilden und nicht jede Person genau einem Stil entspricht. "Jemanden nicht mehr zu daten, weil der Bindungstyp nicht passt, davon rate ich ab. Ein Warnsignal sind Schmetterlinge. Sie deuten eher darauf hin, dass man etwas Bekanntes wiederholt." Sichere Typen verlieren etwa bei Vermeidern schnell das Interesse, da sie schlicht erkennen, dass das distanzierte Verhalten des Gegenübers sie nicht glücklich macht. "Hat man genügend Selbstbewusstsein und ein Leben, das einem gefällt, dann wird es unattraktiv, wenn ein anderer Mensch einen nicht will", erläutert Blum.
Umgekehrt können sicher gebundene Menschen als langweilig oder nicht eroberungswürdig wahrgenommen werden, wenn man selbst zur Unsicherheit tendiert. Doch gerade klammernde Typen können von einer Verbindung mit einer sicheren Person profitieren, da ihre Geduld und ihr Vertrauen dafür sorgen, dass sich der ängstliche Typ sicher fühlt.
Bestimmte Muster lassen sich auch in der Bindungstheorie einordnen, etwa Menschen, die sich zu schnell verlieben und die betreffende Person idealisieren. "Menschen, die sich schnell verlieben, können auch eine innere Leere oder Einsamkeit in sich fühlen und versuchen, diese dann mit einer Blitzliebe zu bekämpfen. Man hat dann oft die Vorstellung, dass eine glückliche Beziehung das absolute persönliche Glück ist. Man denkt, dass man unbedingt einen Partner braucht, um sich vollständig zu fühlen", sagt Blum.
Aber auch der gegensätzliche Fall, nämlich niemanden interessant oder anziehend zu finden, kann ein Hinweis auf ein falsches Bindungsverhalten sein. "Wenn man sich in einer Phase befindet, wo man keine Lust oder Energie für eine Beziehung hat oder Angst hat, verletzt zu werden, kann man sich oft gar nicht richtig auf einen anderen Menschen einlassen und sich ihm gegenüber öffnen." Singles, die unbewusst noch nicht bereit sind, sich wieder zu öffnen, finden plötzlich vergebene Menschen anziehend oder solche, die von vornherein eine Beziehung ablehnen. Blum schreibt dies einem geringen Selbstwert zu, denn wer die eigenen Emotionen zurückhält, sucht sich jemand aus, der emotional ebenso wenig verfügbar ist.
Wer sich hingegen der eigenen Bedürfnisse bewusst wird, sorgt dafür, sich nicht wieder und wieder auf dieselben dysfunktionalen Beziehungen einzulassen. Eine Garantie dafür, dass das Gegenüber das passende Bindungsverhalten hat, gibt es laut Blum nie, denn gewisse Muster zeigen sich erst während der Bindung. Beim Kennenlernen sollte man deshalb nicht darauf achten, ob der Bindungsstil passt, sondern ob die Person selbstbewusst ist und sich reflektiert.