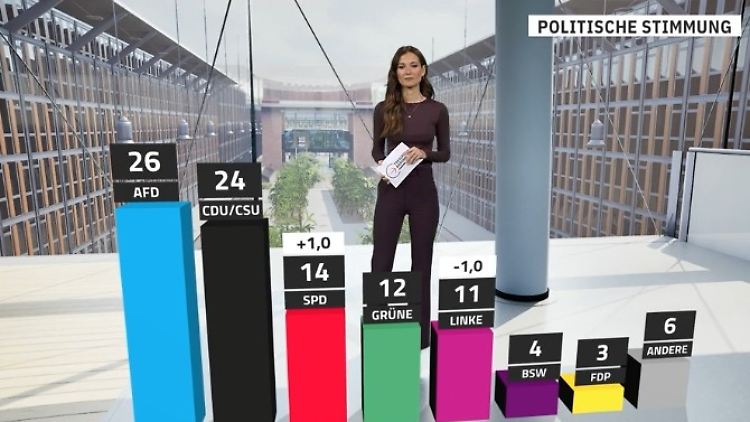Showdown in Österreich "Beide nutzen den Trump-Effekt"
30.11.2016, 10:14 Uhr
Rechts Hofer, links Van der Bellen. Einer der beiden wird österreichischer Bundespräsident.
(Foto: dpa)
Wenn es beim großen Showdown um die Hofburg am 22. Mai 2016 einen Sieger gab, dann Christoph Hofinger. Obwohl der rechte Kandidat Norbert Hofer nach ausgezählten Stimmen vorne lag, prognostizierte Hofingers Umfrageinstitut Sora einen knappen Erfolg für den Grünen Alexander van der Bellen. Er sollte Recht behalten – wenn auch nicht lange. Der Verfassungsgerichtshof kassierte die Wahl, die Wiederholung wurde verschoben, aber am Sonntag soll endgültig entschieden werden, wer das neue Staatsoberhaupt Österreichs wird. Im Interview mit n-tv.de spricht Christoph Hofinger über seine Wahlmüdigkeit, den möglichen Einfluss des Wahlsiegs von Donald Trump auf die Stichwahl und den Erfolg der FPÖ, der den deutschen Großparteien zu denken geben sollte.
n-tv.de: Satte 196 Tage liegen zwischen der ersten Stichwahl und diesem Sonntag, wenn endlich entschieden werden soll, wer der nächste österreichische Bundespräsident wird. Hand auf's Herz – sind Sie langsam wahlmüde?

Christoph Hofinger leitet das Politik- und Sozialforschungsinstitut Sora, das für den Sender ORF die Hochrechnungen erstellt und zusammen mit Forsa bei den deutschen Bundestagswahlen Zahlen für RTL liefert.
(Foto: ORF/Milenko Badzic)
Christoph Hofinger: Nicht was den Einsatz am Wahltag betrifft – der hat für mich und meine Kollegen einen eigenen Zauber, weil wir stolz sind, für die Demokratie in unserem Land arbeiten zu können. Es könnte ja ein extrem spannender Tag werden, und dazu kommt die internationale Aufmerksamkeit. Für Adrenalin ist in unserem Team sicher gesorgt.
Ich gebe aber zu: Die Wahlkampf-Berichterstattung konsumiere ich derzeit manchmal mehr aus beruflichem Pflichtgefühl als aus Begeisterung.
Im Mai war die Stimmung im Land elektrisiert, der Zweikampf zwischen Hofer und van der Bellen hat polarisiert, die Wahlbeteiligung war mit 72,6 Prozent hoch. Wird das am Sonntag ähnlich sein?
Ziemlich sicher, ja. Es gibt keinen Hinweis, dass sie deutlich fallen würde. Es könnte ja auch ein ähnlich spannendes Rennen werden wie am 22. Mai. Viele haben die Investition auf sich genommen, im Mai zu wählen, und werden das wieder tun, auch wenn es keinen Spaß macht.
Wenn die Wahlbeteiligung gleich ist, wird wohl das gleiche Ergebnis herauskommen – oder rechnen Sie ernsthaft damit, dass Wähler von Hofer zu Van der Bellen wechseln oder andersherum?
Sehr wenige, das haben wir schon bei den Veränderungen zwischen dem ersten Wahlgang und der Stichwahl gesehen, da gab es zwischen den beiden kaum direkte Wechsel. Wer gewinnt, hängt vom Austausch der Nichtwähler ab. Wer dieses Reservoir mobilisiert, wird Präsident.
Aber eigentlich ist ja alles gesagt, die Wählerinnen und Wähler kennen die Kandidaten nach diesem langen Wahlkampf wahrscheinlich besser als ihre eigenen Nachbarn. Kommt vielleicht dem Sieg von Donald Trump eine besondere Rolle zu?
Da gibt es nur Vermutungen, aber beide Lager versuchen, den Erfolg von Trump für sich zu nutzen. Die Hofer-Kampagne leitet daraus Rückenwind für ihren Anti-Establishment-Kandidaten ab. Und Hofer sieht sich wegen der guten Kontakte zu Russland und Putin, den ja auch Trump schätzt, als möglicher Vermittler zwischen USA und Russland gefragt. Die Van der Bellen-Seite hatte dagegen im Herbst Sorgen, dass ihre Wähler zu entspannt waren und zu sicher, dass ihr Kandidat wieder gewinnen würde. Die unerwartete Niederlage Clintons unterstützt Van der Bellens Argument, dass es wieder auf jede Stimme ankommen werde.
Am 4. Dezember dürfen 6.399.572 wahlberechtige Österreicherinnen und Österreicher über ihren Präsidenten abstimmen – im mittlerweile dritten Wahlgang. Am 24. April 2016 hatte der rechte Kandidat Norbert Hofer (FPÖ) einen überraschenden Sieg gefeiert, aber mit 35% die absolute Mehrheit verpasst. In der Stichwahl am 22. Mai unterlag er mit 30.000 Stimmen Unterschied dem Grünen Alexander van der Bellen .Die FPÖ verlangte jedoch vor dem Verfassungsgerichtshof wegen Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung der Wahlkarten eine Wiederholung, und bekam am 1. Juli Recht. Der avisierte Nachholtermin am 2. Oktober musste erneut verschoben werden, weil der Kleber an den Wahlkuverts nicht funktioniert hatte.
Auch, wenn man es sich nach der US-Wahl kaum noch zu fragen traut: Was sagen uns die aktuellen Umfragen?
Too close to call. Es bewegt sich wenig – wie bei zwei Bullen, die Stirn an Stirn herausfinden wollen, wer der Stärkere ist, und für die Beobachter einfach keiner der beiden sich auch nur mehr als einen Zentimeter nach vorne oder hinten bewegt.
Die FPÖ hat den Sieg Trumps gefeiert, als Sieg des Volkes über das Establishment. Gibt es Parallelen zwischen den Wählern Trumps und denen der FPÖ?
Das größte Unterscheidungsmerkmal zwischen FPÖ-Wählern und denen anderer Parteien ist die Zuversicht. Das hängt stark mit Einstellungen zu Vielfalt und Zuwanderung zusammen, ist aber für sich genommen der entscheidende Faktor. Rund 45 Prozent der Wahlberechtigten sehen die Aussichten für die Lebensqualität in den kommenden 5 Jahren pessimistisch. Unter diesen 45 Prozent wählen mehr als zwei Drittel die FPÖ.
Auch in Frankreich könnte die Rechte bald das Staatsoberhaupt stellen, aber dort bildet sich traditionell in der Stichwahl ein Bündnis aller anderen Kräfte gegen die Rechten. In Österreich gibt es das nicht. Warum?
Das hat mit machtstrategischen Überlegungen zu tun. Sowohl SPÖ als auch ÖVP sind mit Freiheitlichen schon Koalitionen eingegangen. Die Große Koalition hat wahrscheinlich nach der nächsten Wahl keine Mehrheit, dann würden wohl SPÖ und ÖVP mit der FPÖ zumindest verhandeln. Die FPÖ ist machtpolitisch schon in der Mitte der österreichischen Politik angekommen.
Ist das der postmortale Triumph von Jörg Haider, der seit 1986 dem Rechtspopulismus den Boden bereitet hat?
Es gäbe auch ohne Haider Rechtspopulismus in Europa, aber viele haben von ihm gelernt: Mit einer konsequenten Strategie aus Tabubruch und Ablehnung der politische Eliten bei gleichzeitigem Fischen in der Mitte kann man sehr starke Wahlergebnisse erzielen, sogar über 30 Prozent kommen.
Sie haben vor einigen Monaten in einem Artikel dargelegt, wie die FPÖ es mit dem sogenannten "Framing" geschafft hat, den Diskurs zu dominieren. Um ihre These zuzuspitzen: In Österreich bestimmt die FPÖ, wie über gewisse Themen gesprochen wird.
Absolut. Die FPÖ gibt eine Sprache vor, die von vielen übernommen wird, die gar nicht das Wertesystem der Freiheitlichen teilen. Es gibt Ausnahmen, aber kommen wir zur Regel: Seit 30 Jahren stellt die FPÖ beim Thema Migration und Zusammenleben ihre Diagnosen in einer kohärenten Sprache. Der politischen Mitte passiert es häufig, dass sie diese Sprache übernimmt, manchmal aus schlichtem Ungeschick, manchmal im Versuch einer Art sprachlichem Appeasement – wir übernehmen einen Teil der freiheitlichen Rhetorik und können dadurch ihren Erfolg eindämmen.
Das widerspricht der Theorie des "Framing", die George Lakoff in Berkeley entwickelt hat. Dieser Ansatz sagt: Wenn ein Politiker erfolgreich politisch kommunizieren will, muss er sich überlegen, welche Wertehaltungen er hat und mit den Wählern teilt – und sich dann eine Sprache suchen, die das ausdrückt. Ein typisches Beispiel: Wenn ein SPÖ-Politiker Strafen für Integrationsverweigerer fordert, mag das der Versuch sein, die Rechtsaußenflanke abzusichern. Der ist aber zum Scheitern verurteilt. Wenn ein SPÖ-Politiker misslungene Integration als böse Absicht ansieht und Strafen als Antwort, stärkt er auf lange Sicht die Haltung der FPÖ – und kann auch kurzfristige Wahlergebnisse kaum zu seinen Gunsten beeinflussen.
Außenminister Sebastian Kurz setzt sich ja neuerdings für das Burkaverbot ein. Vor zwei Jahren sagte er noch im Nationalrat, das sei eine verfehlte Diskussion. Ein Fehler?
Man kann als Mitte- oder Linkspolitiker so ein Verbot thematisieren. Die Frage ist: Was habe ich an eigenen Werten, die ich über diese Forderung ins politische System bringe? Wie unterscheidet sich das Weltbild, das die Wähler bei Kurz wahrnehmen, von dem, was sie bei der FPÖ wahrnehmen? Diese strategische Frage muss sich jeder Politiker stellen, der nicht der FPÖ angehört. Auf Österreichisch nennen wir das die Schmied/Schmiedl-Problematik. Warum soll ich zum Schmiedl gehen, wenn ich auch zum Schmied gehen kann?
Angenommen, Angela Merkel ruft Sie morgen an und sagt: Wir haben jetzt hier in Deutschland die AfD, was sollen wir tun? Was sagen Sie der Kanzlerin?
SPD und CDU können in Österreich gut beobachten, was im Wettbewerb gegen den Rechtspopulismus nicht funktioniert. Vor dem ersten Wahlgang zur Bundespräsidentenwahl haben SPÖ und ÖVP gesehen, dass ihre Kandidaten schwächeln und Hofer zulegt. Also haben sie als Große Koalition eine Milliarde für die Polizei und eine Milliarde Euro für das Bundesheer versprochen. Ganz unabhängig davon, ob das sinnvoll war oder nicht, lautete das Signal: Wir sind bedroht. Das half der Erzählung der FPÖ. Die Koalition hätte auch über andere Investitionen sprechen können, die der Wirtschaft Impulse geben, aber diese Vorschläge sind gar nicht erfolgt. Die Parteien, die im Wettbewerb mit Rechtspopulisten stehen, können sehr wohl mitbestimmen, worum es geht. Sie müssten so etwas wie begründeten Optimismus schaffen, das wäre die beste Währung. Mit ein paar strengen Aussagen zu Asyl und Integration Mehrheiten zu retten, das klappt jedenfalls nicht, wie wir in Österreich immer wieder sehen.
Mit Christoph Hofinger sprach Christian Bartlau. In seinem Podcast "Deutsch-Österreichische Freundschaft" beleuchtet Christian Bartlau den Wahlkampf ausführlich.
Quelle: ntv.de