Germany first?"Deutschland kann zu einem neuen Amerika werden"
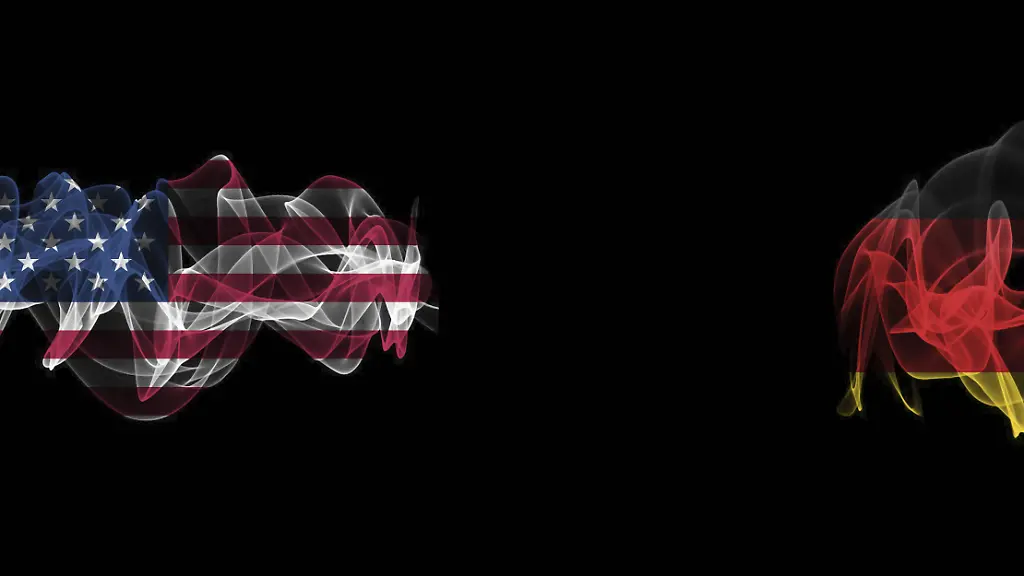
Der Politologe Timo Lochocki plädiert für eine deutsche Führungsrolle in der Welt, da die USA als starker Partner der liberalen Demokratien ausfallen. Dafür müsse Deutschland allerdings zunächst seine nationalen Interessen definieren, sagt Lochocki im Interview mit ntv.de.
Der Politologe Timo Lochocki plädiert für eine deutsche Führungsrolle in der Welt, da die USA als starker Partner der liberalen Demokratien ausfallen. Dafür müsse Deutschland allerdings zunächst seine nationalen Interessen definieren, sagt Lochocki im Interview mit ntv.de.
ntv.de: Sie haben ein Buch mit dem Titel "Deutsche Interessen" geschrieben. Wollen Sie analog zu Trump "Germany First" propagieren?
Timo Lochocki: Nicht analog zu Trump. Zum allerersten Mal müssen deutsche Interessen eigenständig definiert werden - ohne die USA, leider wohl auch ohne Frankreich, denn auch dort könnten bald antidemokratische Kräfte die Regierung übernehmen. Deutschland ist die letzte große liberale Demokratie, wir haben leider keinen großen Partner mehr, der vergleichbare Interessen teilt - vielleicht abgesehen von Großbritannien. Zum ersten Mal haben deutsche Interessen daher auch einen universellen Charakter. Denn Germany first heißt aus meiner Sicht: liberal democracy first.
Aus Ihrer Sicht werden die USA keine liberale Demokratie bleiben?
Seit Trumps Wahlsieg hört man von amerikanischen Freunden Sätze wie: Das ist unser 1933. Mit der Wahl und mit Trumps Amtseinführung haben wir vielleicht den Moment erlebt, an dem sich die USA davon verabschieden, eine liberale Demokratie zu bleiben. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass die USA wieder zu einem stabilen, demokratischen Weg zurückfinden. Im schlimmsten Fall baut Trump das System so um, dass es in vier Jahren keine fairen und freien Wahlen mehr gibt. Im besten Fall können die Demokraten auch wieder eine Wahl gewinnen. Selbst dann laufen wir alle vier Jahre Gefahr, dass jemand wie Trump den Laden übernimmt. Unser Best-Case-Szenario ist also, dass wir alle vier Jahre unseren wichtigsten Alliierten verlieren. Für uns heißt das: Auf diesen Partner können wir uns auf absehbare Zeit nicht verlassen. Wir sollten unsere nationalen Interessen daher auf keinen Fall aufs Engste mit den USA verknüpfen.
Sie weisen in Ihrem Buch darauf hin, dass es der deutschen Exportindustrie und den Banken nicht selten gelungen ist, ihre Interessen als das Interesse der gesamten deutschen Wirtschaft, gar der deutschen Gesellschaft, darzustellen. Wer definiert die deutschen Interessen?
Deutschland hat seine gesamtstaatlichen Interessen bislang nicht definieren müssen, weil wir immer davon ausgegangen sind, dass unsere grundlegenden Interessen weitgehend deckungsgleich mit denen der Amerikaner, Franzosen und Briten sind. Dann haben noch bestimmte Wirtschaftszweige ihren Senf dazugegeben. Auf die Vertretung dieser Interessen konnte sich die deutsche Politik dann konzentrieren. Daher gibt es bei uns keine Kultur, keinen nationalen Denkraum, keine Entscheidungsgremien, die ein nationales Interesse gegen gut lobbyierende Partikularinteressen definieren. Mit meinem Buch möchte ich genau das vorschlagen: dass wir eine Diskussion über unsere nationalen Interessen führen.
Sie fordern, Deutschland solle zur "stärksten Demokratie" der Welt werden. Würde sich die Bundesrepublik damit nicht wahnsinnig überheben?
Ich sage sogar, dass Deutschland zu einem neuen Amerika werden kann und werden sollte, zur mächtigsten liberalen Demokratie der Welt. Natürlich sind die materiellen Ressourcen Deutschlands kleiner als die der USA. Allerdings hat Deutschland ein paar riesige Vorteile. Das ist einmal die Reformfähigkeit Deutschlands, weil bei uns der Kulturkampf erst in den Kinderschuhen steckt. Er nimmt zwar rasant an Fahrt auf bei uns, aber erst in den letzten zwei, drei Jahren - in meinen Augen ist das die größte Katastrophe.
Kulturkampf meint, dass vor allem um identitätspolitische Themen gestritten wird. Was ist daran schlimm?
Je stärker der Kulturkampf geführt wird, also zum Beispiel über Migration gestritten wird, umso mehr verliert ein Land an Kompromissfähigkeit - und ökonomische Themen geraten aus dem Blick. Aber noch ist Deutschland zu Kompromissen fähig, noch gibt es die Möglichkeit zu Zweidrittelmehrheiten in Bundestag und Bundesrat, die massive Reformprojekte anstoßen können. Und noch ist die AfD zu schwach, um das zu verhindern. Das wird sie wahrscheinlich auch nach der Bundestagswahl 2029 noch sein. Das heißt, im krassen Unterschied zu anderen Staaten sind wir zu massiven Reformen fähig. Das gilt auch ökonomisch: Teile der deutschen Debatte über den hiesigen Schuldenstand sind fiskalpolitisch kompletter Humbug. Unser Schuldenstand ist so niedrig, wir sind so kreditwürdig, dass wir über zehn Jahre jährlich 100 Milliarden Euro an Schulden aufnehmen und in Verteidigung, Bildung und Innovationen investieren können. Wir könnten so enorme Reformen anstoßen, zu denen andere Staaten nicht in der Lage sind. Deutschlands Machtfähigkeit ist doppelt so stark wie die französische und halb so groß wie die der USA. Damit kann man nicht die Welt aus den Angeln heben. Aber man kann doch einige Dinge in der Welt so lenken, wie man es selbst für richtig hält. Und wir können Europa sicher sehr stärker mehr so gestalten, wie es im Interesse aller liberalen Demokratien liegt.
Sie beschreiben AfD und Grüne als Hauptprotagonisten des Kulturkampfes, aber nicht als gleichermaßen gefährlich. Liegt darin nicht ein Widerspruch?
AfD und Grüne sind die beiden Pole des Kulturkampfes, aber unter den Parteien sind es vor allem die Union und die Grünen, die diesen Kulturkampf führen. Die AfD alleine würde es nicht schaffen, den nationalen Diskursraum auf die kulturelle Achse zu setzen. Dafür braucht sie immer die anderen, die in der Mitte der Bevölkerung Vertrauen genießen. Deshalb sind die Hauptbetreiber des Kulturkampfes CDU/CSU und Grüne.
Sie beschreiben eine stärkere Staatsverschuldung als Voraussetzung dafür, dass Deutschland stark werden kann. Wie soll das gelingen, wenn der nächste Kanzler Friedrich Merz heißt?
Zunächst einmal ist das Rennen ums Kanzleramt aus meiner Sicht sehr viel offener als man denkt. Und dann ist die Union bereits dabei, ihre Haltung zur Schuldenbremse zu verändern. Die Position der FDP wird mittlerweile auch von vielen Unternehmern scharf kritisiert. Die sind ja auch darauf angewiesen, dass Deutschland verteidigungsfähig ist, dass die Infrastruktur nicht verrottet, die brauchen Investitionshilfen, um auch nur zurück in die Nähe einer Weltmarktführerschaft zu kommen.
Ich glaube, man kann eine Lockerung der Schuldenbremse am ehesten mit der Union machen, wenn man mit der Verteidigungsfähigkeit und mit der Notwendigkeit von Innovationsförderung argumentiert - denn natürlich dürfen wir uns nicht für konsumtive Ausgaben verschulden. Mit der Union wäre vielleicht eine jährliche Schuldenaufnahme von 30 Milliarden Euro für Verteidigung und 70 Milliarden für Innovationen machbar. Schon das wäre ein fundamentaler Schritt in die richtige Richtung. Beides ist fiskalpolitisch kein Problem und würde Deutschland binnen weniger Jahre sicherheitspolitisch und vom Innovationspotential her wieder in eine Führungsrolle bringen.
Ist die Schuldenbremse nicht mittlerweile auch Teil des Kulturkampfes? Wäre es für die Union nicht sehr schwer, einen Kurswechsel zu vollziehen?
Ich glaube, diesen politischen Kampf muss man annehmen, und man kann ihn auch gewinnen. Umfragen zeigen, dass die Deutschen - wenn man an den Rändern links und rechts ein paar Prozent abzieht - in dieser Frage guten Argumenten gegenüber sehr offen sind. Wenn man den Leuten erklärt, warum das nötig ist, gehen die bei dem Thema mit. Die deutsche Politik nimmt nur vermeintlich Schulden auf, sie bekommt dafür ja den Gegenwert einer hochleistungsfähigen Volkswirtschaft, der sich enorm gut verzinst. Und man kann das auch leicht erklären: Das ist so, als würde man zur Raiffeisenbank gehen und einen Kredit über 1000 Euro für drei Prozent aufnehmen. Dann bringt man das Geld zur Sparkasse und erhält dort auf die 1000 Euro acht Prozent Zinsen - steigert sein Vermögen also "einfach so" um 50 Euro. Das ist die Situation, in der Deutschland sich aufgrund der Konstruktion der Eurozone befindet. Für jede 1000 Euro, die wir als Schulden aufnehmen und klug investieren, bekommen wir 1050 oder gar 1100 Euro zurück. Wir vermehren also unser Volksvermögen, indem wir "schwäbische Schulden" machen, um die sparsame "schwäbische Hausfrau" zu persiflieren.
Ihr Buch ist von einem konsequenten Optimismus durchzogen. Woher nehmen Sie den, wenn Ihr zentrales Thema doch ist, wie sehr die Demokratien in Gefahr sind?
Wir können an den anderen Staaten sehen, die schon seit zwanzig Jahren tief im Kulturkampf stecken, was da alles schiefgegangen ist. Das ist unser Vorteil. Wir wissen, welche Gegenmaßnahmen nötig sind: ein Bündel aus Reformen, zu denen wir politisch in der Lage sind und für die wir ökonomisch stark genug sind. Die aktuelle Larmoyanz, das ganze Gejammer in Deutschland steht im kompletten Widerspruch zu unserer realen Handlungsfähigkeit. Wir haben alle Möglichkeiten in der Hand, damit dieses Land eine rosige Zukunft hat und sogar ausstrahlt auf andere Demokratien und eine weltweite Führungsrolle einnehmen kann.
Von 2019 bis zur Bundestagswahl 2021 haben Sie im Bundesgesundheitsministerium im Leitungsstab unter Jens Spahn gearbeitet. Wie sehr sind Ihre Positionen CDU-geprägt?
Wenn einem Patriotismus nicht fremd ist und man an einen starken Staat glaubt, wenn man davon ausgeht, dass es so etwas gibt wie ein Gemeinwohl, das zuweilen wichtiger ist als Individualinteressen, dann ist das ein bürgerlicher Standpunkt, ebenso die klare Präferenz zu einer handlungsfähigen Bundeswehr und einem deutschen Führungsanspruch in Europa. Das teile ich. Meine Kapitel zur Steuer- und Sozialpolitik dagegen liegen vermutlich näher am Seeheimer Flügel der SPD, vielleicht auch am Arbeitnehmerflügel der Union. Aber eigentlich sehe ich meine Positionen nah an dem, was alle deutschen Mitte-Parteien unterschreiben könnten.
Und die FDP mit ihrer Haltung zur Schuldenaufnahme?
Da liegt in der Tat die größte Differenz. Das ist der Dreh- und Angelpunkt: Um die deutschen Ressourcen zu mobilisieren, muss man Geld in die Hand nehmen, viel Geld. Wir müssen verstehen, dass wir viel mehr Geld verdienen, je mehr wir davor klug investieren. "Schwäbische Schulden" erlauben uns genau das.
Mit Timo Lochocki sprach Hubertus Volmer
