Neid-Debatten und Skandale in Deutschland "Steinbrück ist beschädigt"
02.11.2012, 11:31 Uhr
Dem politischen Gegner kommt die Debatte um Peer Steinbrücks Millionen gelegen.
(Foto: dpa)
Im Streit um seine Nebeneinkünfte sucht Peer Steinbrück die Flucht nach vorn. Doch der Kanzlerkandidat steht weiterhin in der Schusslinie. Wenn's ums Geld geht, verstehen die Deutschen keinen Spaß. Im Interview mit n-tv.de spricht der Skandalforscher Hans Mathias Kepplinger über zu Guttenberg, Schavan und Steinbrück.
Im Streit um seine Nebeneinkünfte sucht Peer Steinbrück die Flucht nach vorn. Doch der Kanzlerkandidat steht weiterhin in der Schusslinie. Wenn's ums Geld geht, verstehen die Deutschen keinen Spaß. Im Interview mit n-tv.de spricht der der Publizist Hans Mathias Kepplinger über zu Guttenberg, Schavan und Steinbrück.

Negative Schlagzeilen: Annette Schavan und Peer Steinbrück müssen sich gegen - unterschiedliche - Vorwürfe wehren.
(Foto: picture-alliance/ dpa)
Herr Kepplinger, auf einer Skala von null bis zehn: Wie viel Skandal steckt in dem Streit um Steinbrück und seine Nebeneinkünfte?
Objektiv betrachtet nur eins oder zwei. Wenn man es auf die deutsche Mentalität bezieht, würde ich sagen sechs. In Deutschland wird alles, was mit Geld oder geldwerten Vorteilen zu tun hat, sehr schnell zum Skandal.
Wie beurteilen Sie die Auseinandersetzung um die Plagiatsvorwürfe gegen Annette Schavan?
Wenn sie eindeutig überführt wird, ist das schon eine sechs oder sieben, sehr gravierend. Ob sie wirklich plagiiert hat, ist ja noch offen. Nach allem, was man erfahren kann, ist es ein Grenzfall. Ich halte die Vorverurteilung von Frau Schavan für problematisch. Die bleibt an ihr hängen, auch wenn sich der Vorwurf als nicht tragfähig herausstellt.
Woran liegt das?
Das ist eine Konsequenz der beschränkten Aufmerksamkeit. Die Öffentlichkeit und die Menschen erinnern sich immer vor allem an die Dinge, über die besonders intensiv berichtet wurde. Irgendwann vergessen sie die Einzelheiten, aber eine allgemeine Vorstellung bleibt übrig. Ach, da war doch was! Ein Beispiel ist der Fall Barschel. Kaum jemand weiß, inwieweit die Vorwürfe damals Bestand hatten oder widerlegt wurden.
Was heißt das für die Person, die in der Kritik steht?
Die Betroffenen sind in einer fatalen Situation. Sie müssen mit der Vorstellung leben, dass viele sie für moralisch verwerflich, minderwertig und verachtenswert halten, sobald sie einen Raum betreten.
Das ist wie mit der berühmten weißen Weste.
Ja. Das ist wie die Geschichte von dem Mann, der bei einem Bankett sitzt. Ein anderer stößt ihn an und es fällt etwas von der Gabel auf seine Hose. Wenn er den ganzen Abend mit der befleckten Hose rumläuft, will er irgendwann auch nicht mehr erklären, dass es gar nicht seine Schuld war.

Als Verteidigungsminister suchte Karl-Theodor zu Guttenberg die Inszenierung.
(Foto: picture alliance / dpa)
Wie befleckt ist die Weste von Schavan?
Im wissenschaftlichen Bereich ist sie gravierend beschmutzt, aber nicht so sehr wie bei zu Guttenberg. In der Bevölkerung hinterlässt das keine nennenswerten Spuren. 90 Prozent der Menschen haben keine Vorstellung, wie man eine Dissertation schreibt. Aber das allgemeine Urteil reicht, um eine Person dauerhaft zu diskreditieren. Es bleibt etwas an ihr hängen, wenn sich der Vorwurf als falsch herausstellt.
Wie reagiert man am besten auf Vorwürfe? Hat man überhaupt eine Chance, ihnen zu entkommen?
Man hat eine gute Chance, wenn man eine plausible Erklärung für das eigene Verhalten vortragen kann. Wenn man deutlich machen kann, dass man nicht der Einzige ist, der so gehandelt hat, sondern die meisten so etwas tun, oder dass man in einer Zwangssituation war, die das rechtfertigt.
Ein Beispiel?
Ein herausragendes Beispiel ist Joschka Fischer, …
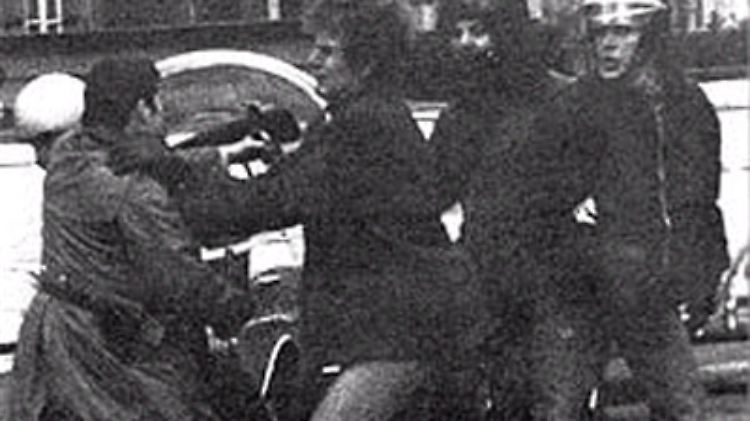
Am 7. April 1973 wird der Polizist Rainer Marx brutal zusammengeschlagen. Mit dabei ist auch Joschka Fischer (2.v.r).
… der vor 2001 in der Kritik stand, als Bilder aus den 70ern auftauchten, die zeigten, wie er auf einen am Boden liegenden Polizisten einprügelt.
Er hat zugegeben: "Wir haben geschlagen, aber wir wurden auch geschlagen." Es ist immer gut, wenn man zeigen kann: Ich war nicht nur Täter, sondern auch Opfer. Außerdem hat er die Erklärung angeboten, diese Auseinandersetzung sei typisch für die 68er gewesen. Das ist zwar falsch, denn das Verhalten war sicherlich nicht typisch für alle 68er. Aber aus Sicht vieler Beobachter war Fischers Aussage glaubhaft, was auch daran liegt, dass sich viele Journalisten von den Angriffen gegen Fischer selbst angegriffen fühlten, weil sie sich zu den 68ern zählten. So konnte sich Fischer gut aus der Situation befreien.
Zu Guttenberg ist das Negativbeispiel in seiner Reaktion auf Vorwürfe?
Er hat alles falsch gemacht. Er hat dementiert, was nicht mehr zu dementieren war. Damit hat er die Skandalisierung immer wieder verlängert. Seine Glaubwürdigkeit wurde immer weiter erschüttert und schließlich zerstört. Und dann bot zu Guttenberg eine Erklärung an – er sei so unter Druck gewesen und habe die Kontrolle verloren –, die nicht nachvollziehbar war.
Wird das immer an ihm haften, auch, wenn er mal zurückkehrt?
Ich bin sicher, er wird auf die Bühne zurückkehren, aber das wird sicherlich noch einige Jahre dauern. Aber die Vorwürfe werden nicht groß an ihm hängenbleiben, weil er außerordentlich beliebt war und ist, und weil er gegen eine Regel verstoßen hat, die für 90 Prozent der Bevölkerung sowieso nicht nachvollziehbar ist. Die meisten haben in der Schule abgeschrieben und irgendwo geschummelt. Der Vorwurf erscheint vielen als kleinlich.

Professor Hans Mathias Kepplinger lehrt Politik- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Mainz.
(Foto: privat)
Peer Steinbrück hat die Flucht nach vorne angetreten und alles offen gelegt, so richtig zu nutzen scheint es ihm trotzdem nicht.
Er hat das einzig Richtige getan. Aber zu den Geldgebern gehörten öffentliche Einrichtungen, auch eine Kanzlei, die zu seinen Ministerzeiten für ihn gearbeitet hat. Das hat etwas Anrüchiges. Ein weiteres Problem ist die Klientel der SPD. Viele werden nicht verstehen werden, dass jemand 15.000 Euro für einen Vortrag von ein, zwei Stunden bekommt. Das wird auch im Unterschied zu Schavan deutlich. Bei ihr verstehen viele Menschen gar nicht, was daran schlecht sein soll, wie sie etwas zitiert oder nicht zitiert haben soll. Die Plagiatsvorwürfe sind jenseits der eigenen Lebenserfahrungen von vielen.
Ja. Denn alle Menschen verdienen Geld. Aber für die meisten ist ein Honorar mit so einem Stundenlohn unvorstellbar. Das trifft auf Neid, und in Deutschland ist Neid in Bezug auf Geld der Anlass für die meisten Skandale. In Amerika wäre das anders. Da würden die Leute sagen: Super, das ist ja toll, wie der das macht. Das würden sie schätzen als Ausweis für besondere Intelligenz und Cleverness.
Wie wahlentscheidend könnte das sein für Steinbrück?
In Deutschland entscheiden ja wenige Prozentpunkte eine Wahl. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Affäre die SPD zwei Prozente kostet.
Wie lange werden diese Millionärs-Vorwürfe noch an ihm haften?
Sie werden ihn innerlich noch sehr lange beschäftigen. Bei seinem Auftritt am Mittwoch im Willy-Brandt-Haus hat man gesehen, wie sehr er darunter leidet. Aus den Medien werden die Vorwürfe bald verschwinden, aber unmittelbar vor der Wahl lassen sie sich natürlich sehr gut reaktivieren.
Ist der Kandidat beschädigt?
Ja, in Teilen der Bevölkerung ist er auf jeden Fall beschädigt. Das Unangenehme für die SPD ist, dass es genau die Teile sind, auf die es ankommt.
Wieso geht man in Deutschland anders um mit Skandalen?
Es ist die mangelnde Sicherheit in der deutschen Bevölkerung. Das Land wurde durch zwei Weltkriege total durcheinandergewirbelt, es gab ungeheure Vermögensverluste. Viele Leute mussten ihre Existenz vollkommen neu aufbauen. Das führt zu einer inneren Verunsicherung, die ich sonst nur in Israel gefunden habe. Zu einer besonders ausgeprägten Aufmerksamkeit für alles, was aktuell passiert. So etwas findet man in Frankreich und England nicht, da sind ganz andere Verhältnisse. Deutschland ist aufgrund der historischen Abläufe in höchstem Maße verunsichert und deshalb auch reaktionsfähig, im negativen wie im positiven Sinn.
Wie wird das im Ausland beurteilt?
Aus der Sicht des Auslands sind die Deutschen hysterisch, das betrifft das Waldsterben, das betrifft BSE, das betrifft unser Verhalten nach Fukushima. Da schütteln die meisten Ausländer in Frankreich, Italien, England, Spanien und Amerika den Kopf. Die sagen: Die spinnen, die Deutschen.
Mit Hans Mathias Kepplinger sprach Christian Rothenberg
Quelle: ntv.de









