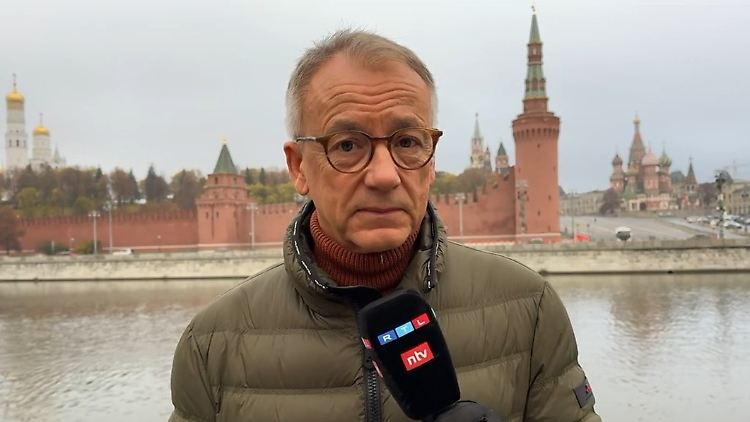Staat in Gänsefüßchen DDR verteufelt Springer Verlag
25.10.2009, 11:19 UhrDer Springer Verlag war 30 Jahre lang einer der größten Feinde der DDR. Als "Kriegshetzer" oder "Feind der Arbeiterklasse" wurde er beschimpft und angegriffen - nicht nur von der DDR.

1968 steigert sich auch der Zorn der Westdeutschen auf den Axel Springer Verlag (Archivfoto vom 15. April 1968).
(Foto: picture-alliance/ dpa)
Es war eine der großen Medienschlachten im Kalten Krieg: "Lügenkonzern", "Manipulationsmaschine", "Fälscherwerkstatt" - 30 Jahre lang hatte die DDR-Führung den Axel Springer Verlag als Feind im Visier. Als "Kriegshetzer" oder "Feind der Arbeiterklasse" wurde das Medienhaus aber auch von westdeutschen Linken angeprangert. Springers Zeitungen "Bild" und "B.Z." gifteten zurück - gegen "Zonenmachthaber" und "linke Chaoten", die "DDR" kam in den Blättern nur in Gänsefüßchen vor. Zwanzig Jahre nach dem Mauerfall wird das Katz-und-Maus-Spiel zwischen dem SED-Staat und Europas größtem Zeitungsverlag erstmals in einem Buch und einer TV-Dokumentation mit vielen pikanten Details nacherzählt.
"Feind-Bild-Springer - ein Verlag und seine Gegner" - unter diesem Titel ist der Forschungsverbund SED-Staat der Freien Universität Berlin im Auftrag des Medienkonzerns der engen Feindschaft nachgegangen. Bis heute muss sich der Konzern mit den Angriffen herumschlagen. Ein von Vorstandschef Mathias Döpfner einberufenes "Springer-Tribunal" in Anspielung auf das "Springer Tribunal" von 1968 musste abgesagt werden. Die "Alt-68er", die einst die Enteignung Springers gefordert hatten, wollten sich nicht an einen Runden Tisch mit den Gegnern von einst setzen.
Ulbricht ruft die "Anti-Springer"-Kampagne aus

Walter Ulbricht sieht im Axel Springer Verlag einen Feind des Sozialismus.
(Foto: picture-alliance/ dpa)
Dabei hatten noch Ende der 50er Jahre der Verleger Axel Springer und die damals eher unpolitische "Bild"-Zeitung vor allem gegen die Außenpolitik von Kanzler Konrad Adenauer (CDU) gewettert. Springer, der mit seinen Kontakten nach Washington und Moskau seine eigene Außenpolitik betrieb, befürchtete mit der Westausrichtung der Bundesrepublik eine Zementierung der Teilung. Und "Bild" warnte vor dem "Atomtod". Auch in der DDR gab es Überlegungen zur Vereinigung - freilich unter sozialistischem Vorzeichen.
Die Stimmung kippte im Oktober 1966. Auf dem 20. Parteitag rief SED-Chef Walter Ulbricht eine "Anti-Springer"-Kampagne aus. "Ulbricht störte die Entscheidung Springers für Berlin", sagt Jochen Staadt, einer der Autoren der Studie (Verlag Vandenhoeck & Ruprecht). Der Sachse wollte Berlin (West) neutralisieren, "die Springer-Zeitungen schürten dagegen die Fronstadtmentalität".
Links von der Mitte = gegen Springer
Mit seinem Angriff bewies Ulbricht aber auch "ein gewisses Gespür" für die Konflikte in der Bundesrepublik. Denn im Westen nahm die Antipathie gegen Springer zu. Nach dem berühmten Buch des Soziologen Jürgen Habermas über den "Strukturwandel der Öffentlichkeit" wurde der wachsende Einfluss des Medienhauses vor allem von linken Intellektuellen als Gefahr für die Demokratie gesehen. "Es gehörte längst zum Grundkonsens links von der Mitte, gegen Springer zu sein", sagt Staadt.
Im Mittelpunkt der Kampagne stand die Wochenzeitung "Extra-Dienst", die von einem Stasi-IM geleitet wurde. Auch zwei prominente Verleger sahen eine Chance, mit Stimmung gegen Springer eigene Interessen zu befördern. Gerd Bucerius ("Die Zeit") und Rudolf Augstein ("Der Spiegel") wollten in Berlin eine neue Zeitung als Konkurrenz zu den Springer-Blättern etablieren. Als Journalisten waren neben Fritz J. Raddatz oder Arnulf Baring auch mehrere MfS-Spitzel dabei.
Brand siegt trotz Gegenwind von Springer
Doch das Projekt scheiterte, Bucerius zog sich zurück. Die Lage spitze sich nach dem Tod Benno Ohnesorgs zu. Auch das "Springer Tribunal" Anfang 1968 platzte, nachdem sich namhafte Unterstützer zurückgezogen hatten. Nach den Schüssen auf Rudi Dutschke am 11. April 1968 versuchten Studenten, das Verlagshaus in der Kochstraße zu stürmen und setzen den Fuhrpark in Brand.
Mit der Wahl Willy Brandts zum Bundeskanzler 1969 einer SPD/FDP-Regierung ebbte die Kampagne ab. "Die These von Springers Manipulationsmacht erwies sich offensichtlich als falsch. Die sozial-liberale Koalition siegte trotz des Gegenwinds der Springer-Blätter", sagt Staadt.
Eine Genugtuung blieb Gegnern des Konzerns dennoch. Mit seiner Ostpolitik setzte Willy Brandt ein Zeichen - gegen den erbitterten Widerstand der Springer-Zeitungen. Und als die Blätter im August 1989 schließlich auf die DDR in Gänsefüßchen verzichteten, war es ohnehin für eine Annäherung zu spät. Drei Monate später fiel die Mauer.
Quelle: ntv.de, Esteban Engel, dpa