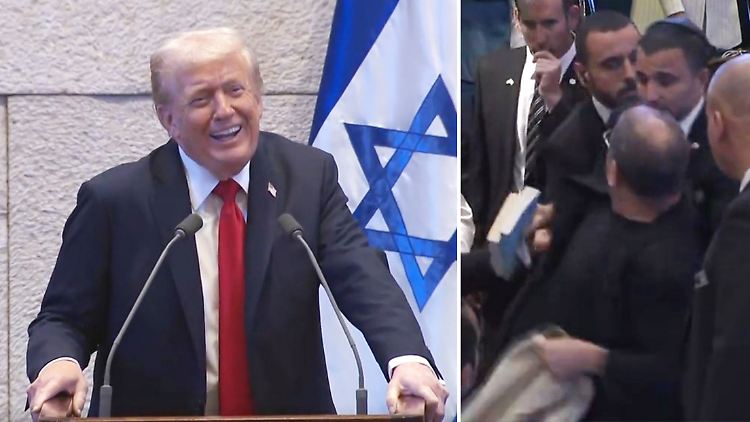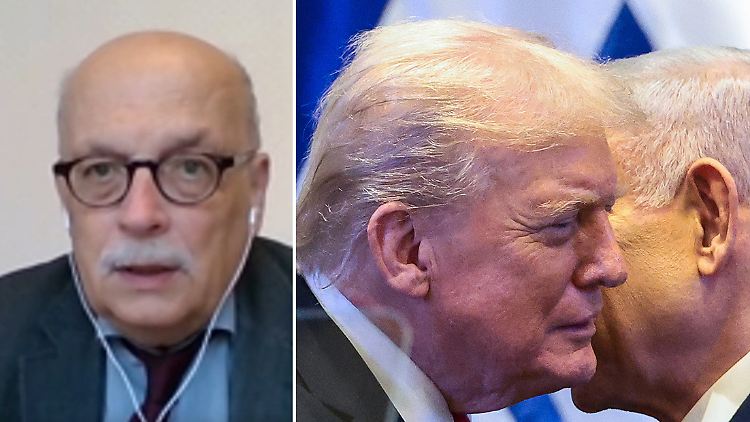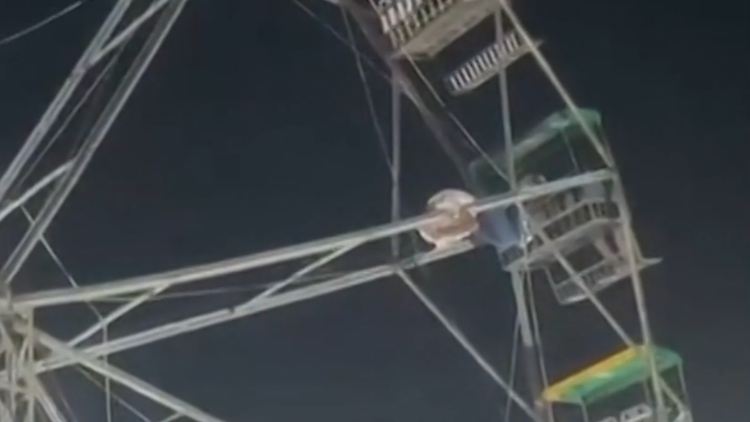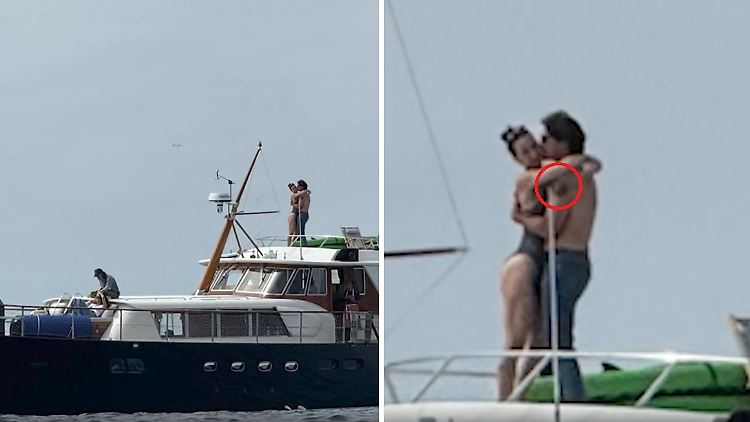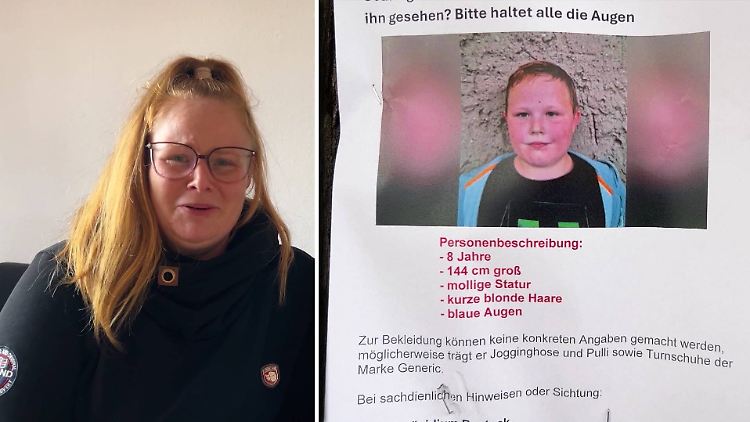Hamburg & Schleswig-Holstein Volksentscheid bringt strengstes Klimagesetz der Republik
13.10.2025, 16:38 Uhr
(Foto: Marcus Brandt/dpa)
Hamburgs Bürger stimmen für ein ehrgeizigeres Klimaziel als bisher in der Hansestadt gilt. Was sich durch den Volksentscheid jetzt ändert – und warum kurzfristig dennoch alles beim Alten bleibt.
Hamburg (dpa/lno) - Hamburg hat sich mehrheitlich für einen strengeren Klimaschutz entschieden. 303.936 Bürgerinnen und Bürger haben bei einem Volksentscheid am Sonntag für ein Vorziehen der Klimaneutralität der Stadt von 2045 auf 2040 gestimmt, das waren 53,2 Prozent. 46,8 Prozent der rund 1,3 Millionen Abstimmungsberechtigte votierten laut Landeswahlamt dagegen, genau 267.495 Menschen. Die Abstimmungsbeteiligung lag bei 43,7 Prozent.
Warum das härteste Gesetz der Republik?
"Wir haben jetzt das mit Abstand fortschrittlichste und ehrgeizigste Klimaschutzgesetz der ganzen Bundesrepublik Deutschland", sagt Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne). Durch den Volksentscheid muss nun die Klimaneutralität der Stadt nicht nur als Ziel für 2040 formuliert sein, sondern es muss von 2026 an einen linearen Pfad zur CO2-Reduktion geben, der jedes Jahr überprüft werden muss. Sollten die Werte nicht stimmen, müssen diese in den Folgejahren kompensiert oder Sofortmaßnahmen getroffen werden. "Das ist was ganz anderes, als eine Absichtserklärung für ein bestimmtes Ziel darzulegen."
Aber auch gesetzgeberisch zählt das neue Klimaschutzgesetz zu den härtesten der Republik. So planen zwar auch das SPD-geführte Niedersachsen und das CDU-geführte Schleswig-Holstein eine Klimaneutralität ab 2040, Bremen peilt sogar 2038 an, doch können diese Länder ihre Regeln einfach wieder ändern, sollten die Ziele nicht zu schaffen sein.
Mecklenburg-Vorpommern geht gerade diesen Weg, dort soll das Ziel von 2040 nach hinten auf 2045 verschoben werden. In Hamburg geht das nicht. Denn sollte die Bürgerschaft den Willen des Volkes missachten, genügen laut Gesetz schon 2,5 Prozent der Wahlberechtigten, also etwa 32.500 Menschen, um den nächsten Volksentscheid zu erzwingen.
Für Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) steht daher fest: Ein Volksentscheid bindet Senat und Bürgerschaft. "Wie es unsere Verfassung und die Rechtslage zur Volksgesetzgebung gebieten, wird der Senat den Volksentscheid umsetzen und den Hamburger Klimaplan an die neuen formalen Anforderungen anpassen."
Was ändert sich denn jetzt?
Erstmal nichts. Das Ziel des Senats und die bisherige gesetzliche Vorgabe, dass in Hamburg die CO2-Emissionen im Vergleich zu 1990 bis zum Jahr 2030 um 70 Prozent reduziert werden sollen, bleiben bestehen, wie Tschentscher sagt. "Das ist deshalb wichtig zu erwähnen, weil der Volksentscheid dadurch nicht zu kurzfristigen neuen Maßnahmen führt, sondern der Senat die bestehenden Planungen für die aktuelle Legislatur grundsätzlich unverändert fortführen kann." Fegebank betont deshalb, es gebe jetzt keinen Grund, "hektisch zu werden oder in Aktionismus zu verfallen".
Also alles ganz einfach?
Grundlegende und weitreichende Änderung durch den Volksentscheid folgten erst von 2030 an, sagt Tschentscher. Einem Gutachten des Hamburg Instituts und des Öko-Instituts im Auftrag der Stadt müssten bis 2040 unter anderem alle Gas- und Ölkessel in Wohn- und Nichtwohngebäuden ausgetauscht werden – bei gleichzeitiger Stilllegung des gesamten Gasnetzes.
Im Wohnungsbau müsste die Sanierung erheblich beschleunigt und der Einbau von mit erneuerbaren Energien betriebenen Heizsystemen wie Wärmepumpen schon jetzt stärker vorangetrieben werden. Im Verkehr wiederum müsste in der ganzen Stadt Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit eingeführt und der Pkw-Verkehr deutlich reduziert werden.
Was davon tatsächlich kommt, ist jedoch noch völlig unklar. "Natürlich haben wir jetzt keine Zahlen oder Schätzungen zu Plänen, die noch entstehen müssen", sagt Tschentscher. Die bislang geplante Klimaneutralität ab 2045 sei bereits mit 400 Maßnahmen untermauert. Und jetzt komme noch mal eine Schwierigkeitsstufe obendrauf. "Das Votum nehmen wir aber an."
Was müssen die EU und der Bund machen?
Eine Klimaneutralität bis 2040 unter der Maßgabe der Sozialverträglichkeit und Bezahlbarkeit ist nach Tschentschers Überzeugung nur möglich, wenn dafür die entsprechenden Voraussetzungen auf Bundesebene geschaffen würden. Tschentscher nannte dabei etwa den Hochlauf der Wasserstoffversorgung oder die CCS-Technologie zur unterirdischen Verpressung von CO2.
Tschentscher warnt auch vor einem Rollback beim Klimaschutz auf Bundes- und Europaebene. "Wer heute immer noch glaubt, dass er ohne Wasserstoff zurechtkommt auf dieser Welt, der hat, glaube ich, das Prinzip der Energiewirtschaft global nicht verstanden." Auch ohne den Volksentscheid wäre es nötig, diese Maßnahmen zu ergreifen. "Deswegen ist es ein Auftrag an die Bundesrepublik - Volksentscheid hin oder her - auch die bundespolitischen Ziele im Klimaschutz zu erreichen." Der Bund dürfe Klimaziele nicht nur einfach proklamieren, sondern müsse sie auch operativ planen und schrittweise erreichen.
Wird das Wohnen jetzt exponentiell teurer?
Die Vorgabe des Volksentscheids lautet, dass der Klimaschutz sozialverträglich und bezahlbar sein muss. So dürfen dem Gesetzentwurf zufolge die Kosten etwa für die energetische Sanierung von Wohnraum nur begrenzt an Mieterinnen und Mieter weitergereicht werden. Vermieter wiederum sollen durch Förderprogramme entlastet werden. Mehrere Immobilienverbände werden dennoch nicht müde, vor Preissteigerungen von drei bis vier Euro pro Quadratmeter zu warnen. Der stellvertretende Vorsitzende des IVD Nord, Carl-Christian Franzen, etwa sagt: "Dieser Tag wird als Wendepunkt in Erinnerung bleiben. Hamburg hat den Klimaschutz nicht gestärkt, sondern seine soziale und wirtschaftliche Balance aufs Spiel gesetzt."
Was ist mit der Wirtschaft und der Industrie?
Der Hamburger Industrieverband hat den Volksentscheid bereits eine "Deindustrialisierung made by Hamburg" genannt. Nun seien Produktionsverlagerungen und Arbeitsplatzabbau nicht mehr ausschließen. Eine Sorge, die Bürgermeister Tschentscher ernst nimmt. "Wir werden diesen Industriestandort mit aller Macht verteidigen", sagt er. "Wir brauchen eine moderne Industrie, auch im Interesse des Klimaschutzes."
Tschentscher verwies darauf, dass in Hamburg eine Tonne Kupfer, Stahl oder Aluminium schon jetzt mit weniger als der Hälfte der CO2-Emissionen verbunden sei als im weltweiten Durchschnitt.
Umsetzung des Volksentscheids gemeinsame Aufgabe?
Fegebank und Tschentscher forderten die Bürgerinnen und Bürger auf, sich an der großen Aufgabe des Klimaschutzes zu beteiligen - egal, ob als Gegner oder Befürworter des Volksentscheids. Das sei jetzt eine gemeinsame Aufgabe im politischen Raum, aber auch in der Zivilgesellschaft und in der Wirtschaft, sagte Tschentscher. "Wir wollen das gemeinsam umsetzen - wir wollen es wirksam, wir wollen es machbar und wir wollen das sozialverträglich machen."
Wie geht es jetzt weiter?
Zum einen wird die Landesabstimmungsleitung die Ergebnisse dem Senat für seine Sitzung am 4. November überstellen. Zum anderen wird der Senat dann nach eigenen Angaben das Endergebnis unverzüglich formal feststellen und das Änderungsgesetz im Hamburgischen Gesetz- und Verordnungsblatt verkünden.
Und sonst so?
Hamburgs Wahlleiter Oliver Rudolf spricht von einem Abstimmungstag ohne Probleme. In lediglich einem Abstimmungslokal im Stadtteil Eimsbüttel sei der Andrang so groß gewesen, dass die Stimmzettel ausgegangen seien. Und die Nachlieferung habe so lange gedauert, dass "bis zu fünf Personen" dann nicht hätten warten wollen. "Das ist natürlich sehr ärgerlich, denn wir wollen, dass alle Stimmberechtigten auch abstimmen können."
Die meisten Ja-Stimmen zum Zukunftsentscheid gab es den Angaben zufolge mit 86,6 Prozent in Wilhelmsburg in der Abstimmstelle Fährstraße, die wenigsten mit 28,3 Prozent in der Abstimmstelle "Schule Neuland" im gleichnamigen Stadtteil.
Quelle: dpa