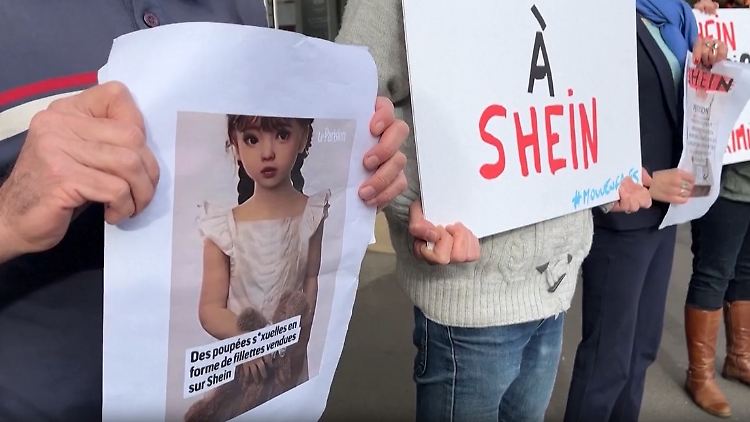Von Finanzaufsicht bis Rettungsschirm Ein Korb voller Zankäpfel
12.07.2010, 15:31 Uhr
Die EU-Finanzminister tragen schwer an ihrer Agenda.
(Foto: picture alliance / dpa)
Auch in Brüssel steigt das Thermometer auf bis zu 38 Grad. Ob die hitzigen Debatten der EU-Finanzminister etwas dazu beitragen? Sicher ist: Die Minister knabbern an den Zankäpfeln.
Der G8/G20-Gipfel in Kanada hat die Welt in Sachen Finanzmarktreform nicht entscheidend weiter gebracht. Vorschläge wie die Bankenabgabe wurden abgeblockt, andere Ideen wie die Finanzmarkttransaktionssteuer vermutlich gar nicht bis zum Ende durchdiskutiert. Außer Spesen leider nichts gewesen – Spesen in Höhe von 1,1 Mrd. Euro. Nun setzen sich die EU-Finanzminister in Brüssel zusammen, um auf EU-Ebene ein neues Regelwerk für die Finanzmärkte auf die Beine zu stellen. Die Themen sind weitgehend dieselben – die Widerstände aber auch. Ein Überblick über die dicksten Zankäpfel:
Zankapfel Finanztransaktionssteuer

Mürbe Stellen: Die Diskussion um die Finanztransaktionssteuer kommt nicht voran.
(Foto: picture-alliance/ dpa)
Trotz des Rückschlages beim G20-Gipfel pochen Deutschland und Frankreich weiter auf die Steuer auf Finanztransaktionen. In einem gemeinsamen Brief an den derzeitigen EU-Ratsvorsitzenden, den belgischen Finanzminister Didier Reynders, fordern Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und seine französische Amtskollegin Christine Lagarde eine beschleunigte Beratung über das Thema. Eine Finanztransaktionssteuer sei "möglich und notwendig", heißt es in dem Brief. Deutschland und Frankreich würden Diskussions-Vorschläge einbringen, um die europäische Lösung voranzubringen. Mit der Steuer sollen die Banken an den Folgekosten der Finanzkrise beteiligt werden. Schäuble plant bereits ab 2012 Einnahmen von rund zwei Mrd. Dollar im Jahr ein.
EU-Steuerkommissar Algirdas Semeta tritt den Forderungen des Duos bereits vor dem Finanzministertreffen entgegen. Es sei einfach, die Forderung nach einer solchen Steuer in die Welt zu setzen, sagt der litauische Kommissar der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Die Kommission muss aber dafür Sorge tragen, dass wir keinen Unsinn beschließen. Wenn die Steuer nachher nicht funktioniert, sind wir die Schuldigen." Zudem dürfe die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Finanzplätze nicht leiden. Er sei nicht sicher, ob im EU-Ministerrat wirklich eine einstimmige Zustimmung für das Projekt zu erzielen sei. Sie wisse, dass Deutschland und Frankreich bei dem Thema in der EU isoliert seien, sagt Lagarde in einem "Handelsblatt"-Interview. Der Internationale Währungsfonds, IWF, habe aber festgestellt, dass die Steuer machbar sei. Allerdings müsse man aufpassen, dass sie keine Kapitalflucht verursache. "Deutschland und Frankreich müssen die anderen Europäer überzeugen."
Mehrere Länder, wie zum Beispiel Großbritannien, lehnen die geforderte neue Abgabe ab. Sie fordern stattdessen schärfere Regeln für die Ausstattung der Banken mit Eigenkapital als Finanzpuffer für den Krisenfall.
Zankapfel Rettungsschirm
In der EU tobt ein Rechtsstreit, ob der beschlossene milliardenschwere Euro-Rettungsschirm für schwächelnde Mitgliedsstaaten im Notfall tatsächlich aufgespannt werden kann. Mehrere vertrauliche Gutachten konnten bislang offenbar nicht klären, ob fehlende Unterschriften von EU-Staaten die mögliche Auszahlung von Krediten an notleidende Euro-Länder verhindern. Am Dienstag wollen die europäischen Finanzminister auf dem Ecofin-Ministerrat politische Klarheit schaffen und den Start des Rettungsschirms verkünden. Zuvor wollen die Euro-Länder versuchen, Wackel-Kandidaten wie die Slowakei zur Teilnahme an den Rettungsschirm zu bewegen. Die Slowakei ist das einzige Land mit Euro-Währung, das nicht mitzieht. Der Vorsitzende der Euro-Finanzminister, Jean-Claude Juncker, will Kreisen zufolge mit dem neuen Ressortchef Ivan Miklos und der christlich-liberalen Premierministerin Iveta Radivoca sprechen und ist zuversichtlich, dass ein Kompromiss möglich ist.
Der Rettungsschirm wurde eingerichtet, um Euro-Staaten notfalls schnell unter die Arme greifen zu können. Der IWF ist auch an dem 750-Mrd-Euro-Rettungsschirm beteiligt, sein Anteil beträgt bis zu 250 Mrd. Euro, den Rest tragen die Euro-Staaten und die EU-Kommission. Bisher wurde der Schirm nicht in Anspruch genommen. Als potenzielle Nutzer gelten Portugal oder Spanien. Für das hochverschuldete Griechenland wurde ein gesondertes Hilfspaket von 110 Mrd. Euro geschnürt.
Neuer Apfel: Insolvenzplan
Eine neue Idee bringt Bundeskanzlerin Angela Merkel mit nach Brüssel. Sie arbeitet gerade an einem Insolvenzplan für überschuldete Staaten der Eurozone. Für den Fall einer Staatspleite im Euro-Raum soll nicht der Steuerzahler die alleinige Last für die Rettung tragen, sondern auch private Investoren sollen ihren Anteil schultern. Der Plan: Kann ein Euroland seine Schulden nicht mehr bedienen, soll vereinbart werden, dass die Inhaber von Anleihen des jeweiligen Staates beispielsweise einer Laufzeitverlängerung zustimmen, sich mit niedrigeren Zinszahlungen zufrieden geben oder eine Rückzahlung der Anleihe zu einem Kurs von weniger als 100 Prozent in Kauf nehmen. In Finanzjargon wird eine solche Lösung als "Haircut" bezeichnet.
Im Gegenzug sollen auch die Schuldenländer selbst höhere Lasten tragen und unter bestimmten Umständen sogar Mitbestimmungsrechte an eine Art Insolvenzverwalter abtreten. Alleine in diesen Punkt drohen schon Unstimmigkeiten, da Wackelkandidaten wie Spanien, Portugal & Co kaum gewillt sein werden, einen Teil ihrer Souveränität abzugeben. Für die Umschuldung selbst könnte ein neuer von der Politik unabhängiger "Berliner Club" zuständig sein – eine Art Neuauflage des 1956 ins Leben gerufenen "Pariser Clubs", der mit Fokus auf Entwicklungs- und Schwellenländer die Umschuldung und den Schuldenerlass zwischen Staaten regelt.
Zankapfel Finanzaufsicht
Auch in Brüssel kommt die Debatte um die neue europäische Finanzaufsicht wieder auf den Tisch, die jüngst im Europaparlament gescheitert war. Es geht um die Schaffung von drei neuen EU-Aufsichtsbehörden für die Banken-, Wertpapier und Versicherungssektoren sowie einen bei der Europäischen Zentralbank angesiedelten "Weisenrat" zur Früherkennung von "systemischen Risiken" für den Finanzsektor.
Die neue Finanzaufsicht soll eigentlich am 01. Januar die Arbeit aufnehmen, weil sich sonst auch andere Reformvorhaben, wie die strengeren Regeln für Rating-Agenturen oder Derivate, sich verzögern könnten. Doch noch ist das Projekt nicht abgenickt. Umstritten ist unter anderem, wie viel Macht gegenüber den nationalen Regierungen und Aufsehern die EU-Agenturen bekommen sollen, etwa wenn sich nationale Regulierer nicht einigen können. Auch ist fraglich, ob sie im Notfall hochspekulative Finanzprodukte verbieten sollen oder nicht. Großbritannien und Deutschland sind gegen starke Durchgriffsrechte auf der nationalen Ebene. Sie sorgen sich beispielsweise, dass sie dazu verdonnert werden, Steuergelder zur Bankenrettung einzusetzen. EU-Parlament und Kommission wünschen sich dagegen mehr Macht für die europäischen Institutionen. Die neue Aufsichts-Architektur sei das "Rückgrat" der Finanzreformen, sagt etwa der zuständige EU-Binnenmarktskommissar Michel Barnier und ruft die Mitgliedstaaten zum schnellen Handeln auf.
Zankapfel Bankenstresstest
Im Kreise der Ressortschefs aller 27 Staaten soll am Dienstag auch das Thema Belastungstests für Banken zur Sprache kommen. Der EU-Gipfel hatte im Juni die Stresstests beschlossen, um die Widerstandskraft der europäischen Branche unter Beweis zu stellen und damit für mehr Vertrauen an den Märkten zu sorgen. 91 Geldhäuser werden getestet, darunter 14 aus Deutschland. Die Ergebnisse sollen am 23. Juli vorliegen.
Medienberichten zufolge ist der Test weniger streng als angenommen. Die Kriterien seien in den Verhandlungen zwischen der EZB, der EU-Kommission und der europäischen Bankenaufsehern "aufgeweicht" worden. So müssen beispielsweise die deutschen Banken die Ergebnisse kaum fürchten. Auch in Brüssel gibt man sich gelassen. "Die Stresstests werden zeigen, dass die Banken nicht alle nackt im Wind stehen", sagte ein EU-Diplomat. Fraglich ist nur, was geschehen soll, wenn einzelne Institute durchfallen. Als die USA vergangenes Jahr ihre Stresstests veröffentlichten, brauchten zehn von 19 Banken plötzlich Milliarden-Kapitalspritzen vom Staat. In Europa gelten die deutschen Landesbanken oder die spanischen Sparkassen als Wackelkandidaten. Umstritten ist noch, welche Ergebnisse veröffentlicht werden sollen. Analysten dringen auf möglich viele Details, um die Märkte zu beruhigen. Experten warnen dagegen vor "Fehlinterpretationen".
Und zum Nachtisch: Defizitsünder
Aus Erfahrung klug will die EU in Zukunft strenger gegen Defizitsünder vorgehen. Bei der Reform der Haushaltsüberwachung sollen in Brüssel Nägel mit Köpfen gemacht werden. Die EU-Finanzminister sollen grünes Licht für eine frühzeitige Kontrolle der Staatshaushalte geben, fordert EU-Wirtschaftskommissar Olli Rehn. Die Kommission schlägt ein Verfahren vor, nach dem die EU schon vor den Haushaltsberatungen in den nationalen Parlamenten zu hoher Verschuldung ein Riegel vorschieben könnte. Die Strafen für Länder, die die Defizitgrenze des Paktes von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts überschreiten sollen künftig früher greifen und härter ausfallen. So soll es im Sündenfall nicht nur mögliche Kürzungen von Geldern aus den EU-Strukturfonds sondern auch von Landwirtschaftmitteln geben. Dabei gehe es allerdings nur um Gelder an die Regierungen. Die Subventionen an die Empfänger, wie etwa Bauern oder Fischern, wären nicht betroffen, betonte Rehn.
Zusätzlich soll Euro-Länder eine zusätzliche Geldstrafe in Form einer unverzinsten Einlage bei der Kommission drohen, wenn sie den Schuldenabbau nicht schnell genug vorantreiben. Das Geld würde zurückgezahlt, wenn das Land seine Vorgaben wieder einhält. Bisher ist eine Geldbuße erst nach einer jahrelangen Prozedur fällig. Bislang scheuen die EU-Finanzminister die drastischen Maßnahmen, weil sie sie als beschämend für die Defizitsünder ansehen.
Apropos Defizitsünder: Als erstes von den neuen Regeln betroffen könnten Bulgarien, Dänemark, Finnland und Zypern sein. Gegen die Länder wollen die EU-Finanzminister bei ihrem Treffen ein Defizitverfahren einleiten.
Quelle: ntv.de, mit AFP/dpa/rts