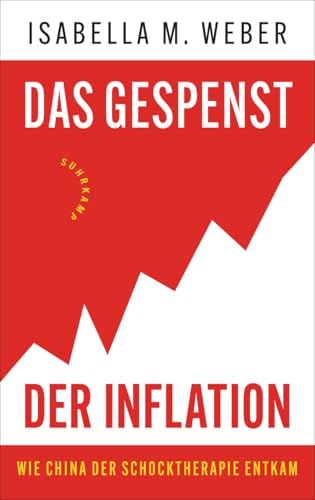Isabella M. Weber im Interview"Wir brauchen einen wirtschaftspolitischen Katastrophenschutz"

Für ihre Forderung, die Inflation nicht nur mit Zinserhöhungen zu bekämpfen, sondern auch mit staatlichen Eingriffen in die Preise, erntete Isabella M. Weber zunächst Kritik und Spott. Später wurde ihre Idee zur Grundlage der Gaspreisbremse. Im ntv.de-Interview fordert die Wirtschaftsprofessorin, jetzt Vorsorge zu treffen für künftige Krisen.
Für ihre Forderung, die Inflation nicht nur mit Zinserhöhungen zu bekämpfen, sondern auch mit staatlichen Eingriffen in Preise wichtiger Güter, erntete Isabella M. Weber zunächst viel Kritik und Spott. Später wurde ihre Idee zur Grundlage der Gaspreisbremse. Im ntv.de-Interview erklärt die Wirtschaftsprofessorin, warum die Geldpolitik der EZB den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährdet. Die Autorin des Buchs "Das Gespenst der Inflation" fordert jetzt eine umfangreiche Vorbereitung der Wirtschaftspolitik auf künftige Krisen.
ntv.de: In Deutschland ist weitgehend Konsens, dass die Inflation konsequent mit Zinserhöhungen bekämpft werden muss - auch wenn das der Wirtschaft und den Bürgern Schmerzen bereitet. Sie kritisieren dieses Vorgehen und fordern stattdessen staatliche Preiskontrollen als eine Art Alternativmedizin gegen die Inflation ganz ohne Nebenwirkungen. Ist das nicht zu schön, um wahr zu sein?
Isabella M. Weber: So weit würde ich nicht gehen! Es gibt keine Wunderwaffe gegen die Inflation. Wenn sie erst mal da ist und sich ausgebreitet hat, dann wird es immer schwieriger, damit umzugehen. Deshalb habe ich schon 2021 gefordert, in die Bresche zu springen und die Feuer zu löschen, als sie gerade ausbrachen, bevor sie wie ein Waldbrand durchs ganze System rasseln. Das hat man damals nicht gemacht, und nun sind wir in dieser schwierigen Situation gelandet. Aber selbst jetzt, wo man den Punkt verpasst hat, an dem man die Brandherde noch relativ einfach hätte bekämpfen können, ist der übliche Instrumentenkasten der Notenbanken, der im wesentlichen aus Zinserhöhungen besteht, nicht das Mittel der Wahl um die derzeitige Inflation zu bekämpfen.
Was sollte sie denn tun?
Man sollte vorgehen wie ein guter Arzt: Bevor man ein Heilmittel verschreibt, sollte man erst einmal überlegen, um welche Krankheit es sich eigentlich handelt. Es gibt unterschiedliche Arten von Inflation, so wie es unterschiedliche Gründe geben kann, warum man Fieber hat. Ich behaupte: Die Inflation, mit der wir es jetzt zu tun haben, rührt nicht wie es in der Vergangenheit oft der Fall war, aus einem Nachfrageüberhang oder übermäßiger Geldmenge her. Die aktuelle Inflation wurde in ihrer ersten Phase durch Impulse aus systemisch wichtigen Bereichen verursacht, in denen die Preise in die Höhe geschossen sind: Energie, Rohmaterialien und Schifffahrt unter anderem. In der Schifffahrt beispielsweise gab es eine Art temporäres Monopol, weil an vielen Häfen riesige Staus waren. Auf einer zweiten Stufe haben dann Unternehmen in allen möglichen Sektoren der Wirtschaft auf diesen Kostenschock reagiert. Dabei haben sie teilweise die Preise stärker erhöht als ihre Kosten gestiegen waren. Diese Preiserhöhungen haben dann zu einem Reallohnverlust für die Bevölkerung geführt, der auch in Deutschland ganz schön gehörig war.
Warum spricht das gegen Zinserhöhungen?
Was bedeutet das, wenn man jetzt auf diese Art von Inflation damit reagiert, die Zinsen hochzuschrauben? Das ist ja eine Maßnahme, die den Arbeitsmarkt "abkühlen", also Arbeitslosigkeit erzeugen soll. Damit bestraft man die Leute, die schon unter der Inflation am meisten gelitten haben, nämlich die lohnabhängig Beschäftigten, die hohe Reallohneinbußen hinnehmen mussten, noch einmal. Das ist dann eine schmerzhafte Art, mit der Inflation umzugehen, bei der die Mehrheit der Bevölkerung zweimal bestraft wird. Bestimmte Unternehmen gehen als Gewinner aus der Krise, andere verlieren stark. Wenn man so damit umgeht, schwächt man nicht nur das Wachstum ab, sondern es entsteht ein Problem für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, vor allem da wir schon vor der Pandemie eine hohe Ungleichheit hatten.
Was folgt aus dieser Erkenntnis konkret? Sollte statt der Zinserhöhungen, der Staat also Preise festlegen, etwa den Autobauern die Autopreise diktieren oder Höchstpreise für Milch und Butter festlegen?
Es geht nicht um pauschale Preiskontrollen sondern um smarte Ansätze wie die Gaspreisbremse. Wie gesagt: Es gibt keine Universalkonzepte, man muss sich einzelne Produktkategorien anschauen. Was man machen kann, um zu vermeiden, dass die Frachtraten von Schifffahrtsunternehmen sich plötzlich vielfachen, ist wahrscheinlich etwas anderes als was wir bei Gas gemacht haben. Und für jeden systemrelevanten Sektor, in dem Preise explodieren, braucht es Experten, die sich zusammensetzen und angucken, was getan werden kann um zu vermeiden, dass die Preise sich multiplizieren. Für die einzelnen Herde der Inflation sind spezifische Lösungen nötig. Die kann ich als Einzelökonomin nicht aus dem Hut zaubern. Deswegen gab es ja zum Beispiel auch eine Gas-Wärme-Kommission, wo wir uns mit vielen Experten wochenlang hingesetzt und versucht haben, für den Gaspreis eine umsetzbare Lösung zu entwickeln. So etwas in der Art hätte es vielleicht auch für Lebensmittel, für den Transport oder den Getreidepreis gebraucht.
Das hört sich nach einem gewaltigen zentralistischen Planungsapparat für alle Bereiche der Wirtschaft an.
Es geht eben nicht um alle Bereiche der Wirtschaft, sondern es geht um bestimmte Bereiche, die, wenn sie aus dem Lot geraten, das Potenzial haben, das gesamte Preisniveau aus den Angeln zu heben und die Wirtschaft zu destabilisieren.
Ist es dafür nicht jetzt ohnehin zu spät? Der Höhepunkt der Krise ist doch inzwischen wohl überschritten.
Wir hatten gerade eine Pandemie und haben den Krieg in der Ukraine. Wir leben aber zum Beispiel auch in Zeiten des Klimawandels, in dem extreme Wetterevents immer wahrscheinlicher werden. Das heißt, es kann durchaus sein, dass in dieser Vielfachkrise noch weitere Schocks auftreten. Wenn man auf jeden Schock mit Zinserhöhungen reagieren möchte, wird einem ganz schnell die Puste ausgehen. Es braucht stattdessen lokale Schockabsorber für die systemisch wichtigen Bereiche. Das könnten etwa bei Gas Pufferlager sein.
Sehen wir nicht, dass sich viele Märkte sehr wohl selbst ganz gut regulieren? Bei vielen Grundnahrungsmitteln sinken die Preise zuletzt wieder. Kann der Staat in diesen Krisensituationen wirklich besser das richtige Maß, die richtigen Preise finden? Liberale Ökonomen würden das wohl bestreiten.
Ich glaube, dass wir uns in einer sehr grundsätzlichen Krisensituation befinden, in der eben viele Krisenmomente aufeinanderprallen. In dieser Situation müssen wir ausbrechen aus der Logik von "hier sind die Liberalen, die mögen Markt" und "hier sind die Linken, die lieben Staatseingriffe". Wir müssen anfangen, über die ganz konkreten Zustände, mit denen wir konfrontiert sind, nachzudenken im Sinne eines wirtschaftspolitischen Katastrophenschutzes. So dass wir vorbereitet sind, wenn solche Schocks ins Mark der Wirtschaft gehen. Wenn Schocks so extrem sind, dass sie nicht verkraftbar sind, muss früher oder später eingegriffen werden. Das hat doch die Gaspreisbremse gezeigt! Es kam einfach zu einem Punkt, an dem die Gaspreise nicht mehr verkraftbar waren. Es drohte, dass Menschen vor der Entscheidung stehen, zahle ich meine Miete oder zahle ich meine Gasrechnung. Das geht schlicht und einfach nicht! Wenn man dann aber nicht vorbereitet ist und keine Konzepte für einen wirtschaftspolitischen Katastrophenschutz hat, dann wird am Ende in allerletzter Sekunde gehandelt. Und dann hat, wer auch immer in dieser Kommission sitzt, auf einmal eine extreme Macht. Wenn man aber mit mehr Vorbereitung agiert, dann hat man auch die Chance, demokratische Teilhabe zu organisieren, breitere gesellschaftliche Diskussionen zu führen. Wenn wir einfach sagen: "Okay der Markt wird's schon richten", und dann richtet er es aber nicht, wenn man die Bremse erst zieht, wenn man schon mit der Zehenspitze über der Klippe ist, dann kann es wirklich zu ungerechten und problematischen Ergebnissen kommen.
Wie könnte das institutionell konkret aussehen in Deutschland, ein wirtschaftspolitischer Katastrophenschutz?
Man kann sich das in Analogie zur Feuerwehr vorstellen, wo es ein Alarmsystem gibt und jeder weiß, was er zu tun hat, wenn ein Feuer ausbricht. Zuallererst braucht es die Anerkennung, dass es Preise gibt, die in bestimmten Situationen systemrelevant sind. Der zweite Schritt ist dann die Frage: Was sind diese systemrelevanten Bereiche in der Wirtschaft, die diese Schlagkraft haben? Dazu haben wir jetzt ein Papier für die USA geschrieben, das ich als Diskussionsaufschlag sehe. Es ist aber noch mehr Forschung auch für andere Länder notwendig.
Wenn man sich dann im nächsten Schritt geeinigt hat, beispielsweise fünf bestimmte Bereiche als systemisch relevant anzuerkennen, dann braucht es als nächstes ein Monitoring, eine Einheit, die zum Beispiel bei der Bundesbank sitzen könnte, da die sich ja ohnehin verschiedene Preise anschaut. Preise sind mächtige Signale. Diese Information sollte genutzt werden, wenn sie eine große Schieflage in einem Markt anzeigen. Wenn beispielsweise wie 2021 die Gaspreise auf einmal extrem steigen, würden die das Wirtschaftsministerium benachrichtigen und sagen: "Beim Gaspreis ist Alarmstufe Orange." Im nächsten Schritt ist dann die Frage, welche Institutionen für welchen Bereich zuständig sind. Wenn es um Energiemärkte geht, dann ist es wohl die Bundesnetzagentur, wenn es um den Bereich Ernährung geht, das Landwirtschaftsministerium und so weiter.
Sie haben sich erstmals vor etwa eineinhalb Jahren öffentlich mit der Forderung nach Preiskontrollen in die wirtschaftspolitische Debatte eingeschaltet. Sie haben zunächst heftige Kritik erfahren. Ihnen wurde aber auch zugehört, Ihre Ideen waren grundlegend für die später umgesetzte Gaspreisbremse. Welche Bilanz ziehen Sie bisher? War das eine ermutigende oder eher ernüchternde Erfahrung für Sie?
Sehr ermutigend ist, dass sich offenbar etwas bewegen kann, wenn der politische Wille da ist und dass auch neue Ideen umgesetzt werden können, wenn der Druck entsprechend groß ist. Insofern ist die Gaspreisbremse eine Erfolgsgeschichte. Allerdings hätte sie viel früher kommen müssen. Der Grund, warum sie nicht früher gekommen ist, ist eine spezifische Haltung in der deutschen Politik, der zufolge Inflationsbekämpfung ausschließlich eine Sache der Zentralbanken und nicht Aufgabe des Staates ist - nicht einmal wenn die wichtigsten Preise explodieren. Deswegen hat es sehr lange gedauert, bis hier in der Politik ankam, was in dieser Krise auf dem Spiel steht: Es geht hier nicht um Inflation als ein abstraktes ökonomisches Konzept, sondern um die Grundfesten unserer Gesellschaft. Wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie jeden Tag auf die Arbeit gehen und genauso anstrengend arbeiten wie vorher, dann aber plötzlich so etwas grundlegendes wie ihre Heizungsrechnung nicht mehr bezahlen können, ohne jedes eigene Verschulden, dann bricht meiner Ansicht nach ein Teil des gesellschaftlichen Vertrages, auf dem Marktwirtschaften beruhen. Deswegen sind Stabilisierungsmaßnahmen wie die Gaspreisbremse für die Funktionsweise der Marktwirtschaft in Schocksituationen unerlässlich.
Glauben Sie, dass sich an der von Ihnen beschriebenen spezifisch deutschen Haltung grundsätzlich etwas geändert hat oder kehren wir, nachdem sich die Lage wieder beruhigt hat und die Inflation zu sinken beginnt, zum alten Verständnis von Staat und Markt der Vorjahre zurück?
Die Herausforderung ist, nachdem die Krise abflaut, Lehren daraus zu ziehen und umzusetzen. Noch ist es zu früh, das zu beurteilen. Noch ist im Politikbetrieb überhaupt nicht verarbeitet, was da 2022 passiert ist, als man ja auf höchster Ebene mit dem Feuerlöscher durch die Wirtschaft gerannt ist, ohne Zeit zu haben, daraus irgendeine Art von Bilanz zu ziehen. Hoffnung, dass wir es schaffen, diese Lehren zu ziehen, habe ich durchaus. Es wird ja viel von der Zeitenwende geredet. Insofern gibt es eine breite Anerkennung, dass wir in einer Zeit des Umbruchs leben. Das sollte auch ein Neudenken von Wirtschaftspolitik beinhalten und Lösungen einbeziehen, die anders als die gegenwärtige Art der Inflationsbekämpfung nicht darauf beruht, gezielt menschliches Leid auszulösen, Bankenkrisen zu riskieren und den wirtschaftlichen Abschwung zu unterwandern.
Das führt zur Ausgangsfrage nach der Medizin ohne Nebenwirkungen zurück: Gibt es andersherum ein Vorurteil zu glauben, wenn ein Mittel nicht weh tut, dann wirkt es auch nicht?
Das ist die Logik der sogenannten Schocktherapie, die bei der radikalen sofortigen Umstellung sozialistischer Planwirtschaften auf weitgehend freie Märkte angewendet wurde. Das ist eines der zentralen Themen in meinem aktuellen Buch "Das Gespenst der Inflation". Diese Schocktherapie beruht genau auf dieser Prämisse: Wenn es nicht weh tut, dann kann es nichts taugen. Ursprünglich stammt der Begriff aus der Psychiatrie. Bei dieser Behandlungsmethode hat man Patienten mit Elektroschocks in Komazustände versetzt, damit sie irgendwie durch den Schock von ihren psychiatrischen Problemen befreit werden. Schocktherapie ist in der Psychiatrie längst überholt. Und ich denke, dass wir in den Wirtschaftswissenschaften auch weg müssen von dieser Idee, dass das, was taugt, weh tut. Wir sollten nicht Maßnahmen ausschließen, weil sie nicht das Kriterium erfüllen, menschliches Leiden zu erzeugen.
Was sind Ihre nächsten Schritte? Sie mischen gerade ja nicht nur die deutsche wirtschaftspolitische Debatte auf, sondern auch die US-amerikanische.
Ich bin auch in den USA aktiv. Zusammen mit einem Kongressabgeordneten habe ich einen Gesetzesentwurf geschrieben, den Emergency Price Stabilization Act. Im nächsten Schritt arbeite ich jetzt an einem Buch, in dem ich versuche, diese vielen Argumente, die ich ja großteils unter dem Druck der Notsituation entwickelt habe, systematisch auszuarbeiten. Damit möchte ich in dem Kontext dieser Zeitenwende nachhaltig zu einem neuen Paradigma der Wirtschaftspolitik beitragen. Dabei will ich auch in die Ideengeschichte zurückzugehen und zeigen, dass es historisch gesehen die große Ausnahme ist, dass wir die Vorstellung haben, dass man noch das wichtigste Grundbedürfnis in Katastrophenzuständen ganz allein durch die Entscheidungen von privaten Akteuren koordinieren kann.
Mit Isabella Weber sprach Max Borowski.