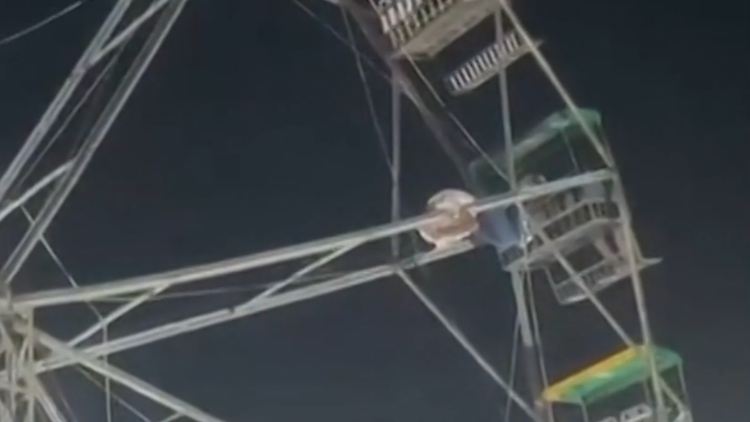Dutzende Mordserien seit 1970 Warum Pfleger ihre Patienten töten
26.02.2015, 19:12 UhrÜber Jahre hinweg spritzt Niels H. Patienten die Überdosis eines Herzmedikaments, nur um sie anschließend wiederbeleben zu können. Das gelingt allerdings nicht immer. Unter Pflegern ist H. keineswegs ein Einzelfall.
Der Tod gehört zum medizinischen Alltag, nicht immer kann die Kunst der Ärzte und Pfleger verhindern, dass ein Patient stirbt. Doch manchmal sterben Patienten, weil Pfleger oder Krankenschwestern es so wollen. Immer wieder werden Tötungsserien in Krankenhäusern oder Altenheimen aufgedeckt. Der Arzt Karl Beine geht in seiner 2011 erschienenen Untersuchung "Krankentötungen in Kliniken und Heimen" von mindestens 35 Serien seit 1970 aus. Inzwischen dürften noch sechs bis sieben hinzugekommen sein, nicht zuletzt die von Niels H. - und einige sind mit Sicherheit noch immer unentdeckt.
Doch warum werden aus Menschen, die andere Menschen wieder gesund machen wollen, Mörder? Niels H. hat ausgesagt, das Töten sei für ihn wie eine Sucht gewesen. Die Entscheidung dafür fiel meist spontan. Hatte er ein geeignetes Opfer ausgemacht, war es eine Sache von Minuten. Er spritzte den Patienten 30 bis 40 Milliliter eines Herzmedikaments, wartete, bis sich ein Kreislaufkollaps oder eine andere Krise abzeichnete und verließ dann schnell das Zimmer. Wenn kurz darauf der Alarm losging, eilte er zurück. Bei der Wiederbelebung kam H. dann als "Rettungs-Rambo" zum Einsatz. So lautete sein Spitzname unter den Kollegen. Der Anklage zufolge wollte er seine Fähigkeiten bei der Wiederbelebung unter Beweis stellen, teils soll er auch aus Langeweile gehandelt haben.
"Das ist kein neues Motiv. Es hat in Tschechien, in England und den USA bereits vergleichbare Täterprofile gegeben, bei denen Täter im intensivmedizinischen Bereich Notfälle herbeigeführt haben, um sich anschließend als grandiose Retter zu präsentieren", erläutert Beine. H. passt damit fast bilderbuchhaft in das Täterprofil mordender Pfleger, wie es Beine skizziert. Denn meist sind die Täter Männer, eine Frau wie "Schwester Tod" ist eher die Ausnahme. Unsicher und mit mangelndem Selbstwertgefühl ausgestattet, wählen sie einen Pflegeberuf, um Wertschätzung zu bekommen. Dann allerdings erleben sie sowohl die Grenzen der medizinischen Möglichkeiten als auch die der gesellschaftlichen Anerkennung. Die eigene Unsicherheit kehrt zurück, hinzu kommt auch noch die Unzufriedenheit. Beine beschreibt die Täter zudem als unfähig, "irreversible Leidenszustände lindernd zu begleiten."
Herr über Leben und Tod
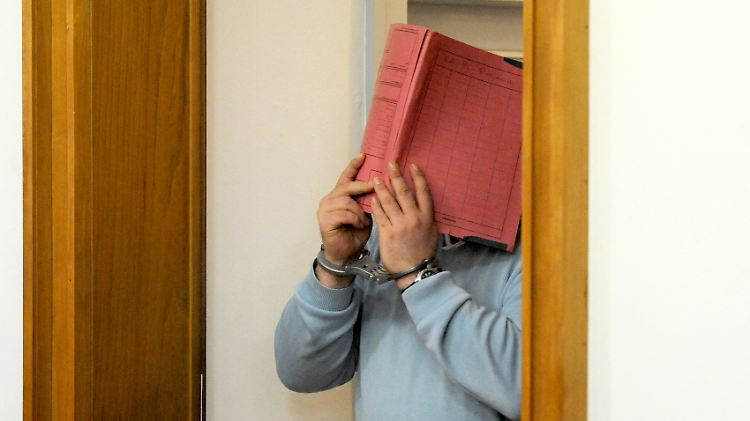
Niels H. behauptet, nur in Delmenhorst getötet zu haben. Doch auch in Oldenburg gibt es ungeklärte Todesfälle.
(Foto: picture alliance / dpa)
Genau das ist aber oft der letzte Dienst an schwer kranken Patienten. Immer wieder berichten Täter davon, dass sie Leiden beenden wollten. Auch Niels H. konnte es nur schwer ertragen, dem Schicksal seiner Patienten ohnmächtig gegenüberzustehen. Tatsächlich maßen sich die Täter an, zu entscheiden, wer weiter leben darf und wer nicht. Die Krankenschwester Irene B., die zwischen 2005 und 2006 an der Berliner Charité fünf Patienten tötete, sprach von "der Macht, zu gestalten". Sie wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. In seinem Urteil zeigte sich das Gericht überzeugt, dass sie in den Tötungen ihrer Machtbesessenheit Ausdruck verliehen hat.
Mit Niels H. hat Gutachter Konstantin Karyofilis über seine Taten gesprochen. Demnach gaben ihm die lebensbedrohlichen Situationen, die der Ex-Pfleger mit seinen Medikamentengaben erzeugte, einen besonderen Kick. Dafür, dass er im Notfall zupackte, bekam H. Lob und Anerkennung. Davon zehrte er dann ein paar Tage, bis ihn der Alltag auf der Intensivstation wieder mehr schlauchte. Er habe in seinen Patienten immer weniger die Menschen sehen können, entwickelte Depressionen und Ängste. Karyofilis bescheinigt H. eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung, die Konsequenzen seines Handelns habe er trotzdem übersehen können. H. nahm den Tod seiner Patienten billigend in Kauf. Nach einer erfolgreichen Wiederbelebung habe er sich gut gefühlt, sagt er vor Gericht aus. Wenn ein Patient gestorben sei, sei er jedoch niedergeschmettert gewesen. Dann habe er sich vorgenommen, damit aufzuhören. Das Gefühl habe aber nicht lange angedauert.
Der Tatort macht es den Tätern doppelt leicht. Auf Stationen mit schwer kranken Patienten gehört auch das Sterben dazu. Niemand denkt sich etwas dabei, wenn Pfleger Medikamente über einen bereits vorhandenen Venenkatheter verabreichen oder eine Spritze setzen. Das Verbrechen wirkt wie eine pflegerische Routinehandlung. Außerdem können die hochwirksamen Arzneimittel Segen und Gift gleichermaßen sein.
Komisches Gefühl bei Kollegen
Trotzdem stellt sich nach Bekanntwerden der Taten oft heraus, dass die Kollegen sehr wohl etwas ahnten oder ein "komisches Gefühl" hatten. Manchmal werden Witze über die ungewöhnlich hohe Sterberate in den Schichten der später überführten Täter gemacht. In den zweieinhalb Jahren, die Niels H. im Klinikum Delmenhorst arbeitete, verdoppelte sich die Zahl der Todesfälle, in den meisten Fällen war H. anwesend. Gleichzeitig stieg der Verbrauch des Medikaments Gilurytmal erheblich, mit dem H. tötete. Bevor H. auf der Intensivstation arbeitete, waren es 50 bis 60 Ampullen im Jahr, am Ende orderte die Station 380 Ampullen. Der zuständige Oberarzt unterschrieb jede Bestellung, ohne nachzufragen.
Auch das ist keine Überraschung: Die Zeit, die zwischen dem ersten Verdacht und der Aufdeckung der Tötungsserie vergeht, ist oft bedrückend lang. Das hat, Beine zufolge, einen simplen Grund: "Niemand im Gesundheitswesen beginnt seine Arbeit dort mit der Absicht zu töten. Alle wollen heilen oder wenigstens lindern." Dem Kollegen einen Mord zuzutrauen, erscheint einfach unmöglich. Selbst bei fragwürdigen Handlungen dauert es deshalb eine Weile, diesen ungeheuerlichen Gedanken zuzulassen. Hinzu kommt oft eine "Mischung aus Unachtsamkeit und bewusstem Wegsehen", wie sie Beine auch in Oldenburg und Delmenhorst feststellt. Dass H. trotz einschlägiger Hinweise auf Unregelmäßigkeiten am nächsten Krankenhaus weiterarbeiten konnte, ist im Nachhinein ein tödlicher Fehler der Verantwortlichen. Weder erhöhte Sterberaten noch der gestiegene Medikamentenverbrauch noch sein eindeutiger Spitzname und seine rohe Sprache über die Patienten bewogen die Krankenhäuser zum Handeln.
Das liegt nach Beines Ansicht auch an einem massiven Aufklärungsdefizit in der medizinischen Ausbildung. "Die Schwierigkeit, nicht änderbares Leid zu ertragen und nicht den Träger des Leides abschaffen zu wollen, ist eine professionelle Tugend, die zu wenig gelehrt wird." Wäre H. 2005 nicht auf frischer Tat ertappt worden, hätte er wohl immer weiter getötet. Vor Gericht sagte er: "Ich habe mich nie beobachtet gefühlt. Ich fühlte mich sicher."
"Krankentötungen in Kliniken und Heimen" bei Amazon bestellen
Quelle: ntv.de