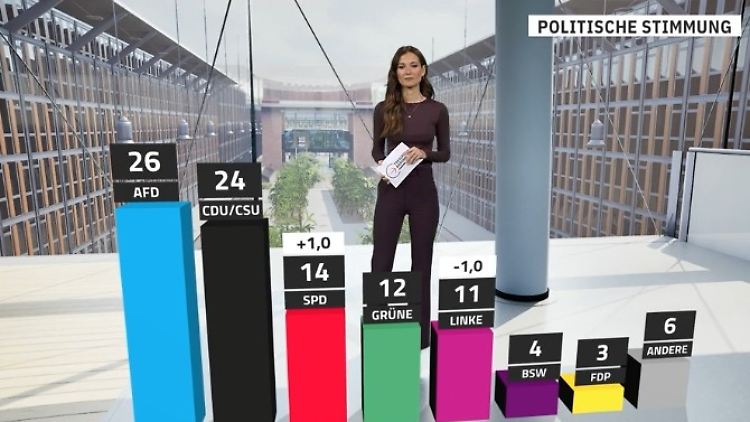OECD warnt Deutschland droht große Altersarmut
26.11.2013, 15:52 Uhr
Eine große Stütze wird die Rente für viele künftig nicht sein.
(Foto: dapd)
Fast jeder vierte deutsche Arbeitnehmer arbeitet für einen Niedriglohn. Damit ist Altersarmut programmiert, warnt nun die OECD. Künftige Rentner müssen hierzulande relativ gesehen mit weniger Geld rechnen als Ruheständler in allen anderen Industrienationen.
Deutschland als Hort der Stabilität, so präsentiert die Bundesregierung das Land am liebsten. Besonders während der Schuldenkrise, die Teile Europas noch immer im Griff hat. Doch Stabilität und Wachstum haben ihren Preis: Jeder vierte Arbeitnehmer verdient weniger als 9,54 Euro pro Stunde – und gilt damit als geringfügig beschäftigt.
Das zeigte im Juli eine Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Damit nicht genug: Auch insgesamt steigt das Armutsrisiko, wie Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen. Vor allem ältere Arbeitnehmer, die zwischen 54 und 64 Jahre alt sind, droht ein großer Einkommensverlust im Rentenalter.
Wer jetzt wenig verdient, wird auch im Alter arm sein. Davor warnt nun die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in einem neuen Rentenbericht. Darin werden Entwicklungen in 27 wichtigen Industrieländern verglichen.
Besonders für Menschen, die nicht ihr ganzes Leben durchgängig voll gearbeitet haben, werde es immer schwieriger, mit dem Geld aus der Rentenversicherung über die Runden zu kommen, heißt es in dem Bericht. Zudem sei die Wahrscheinlichkeit gering, dass Geringverdiener privat Altersvorsorge betreiben können.
Weniger als in allen anderen Industrienationen
Wer nur die Hälfte des durchschnittlichen Einkommens verdient, wird im Alter netto auch nur noch 55 Prozent seiner heutigen Bezüge erhalten. Das sei weniger als in allen anderen Industrienationen, rechnet der OECD-Rentenbericht vor. Dort bekommen Rentner durchschnittlich 82 Prozent ihrer früheren Bezüge. Ein Grund dafür ist die Abhängigkeit der Rentenhöhe von Versicherungsjahren und Beitragshöhe in Deutschland. Andere Staaten hätten bei der Alterssicherung Umverteilungssysteme zugunsten von Geringverdienern eingeführt. In Deutschland waren diese Anfang der 1990er Jahre abgeschafft worden.
"Wir müssen aufpassen, dass die langfristigen Folgen für den sozialen Zusammenhalt und Altersarmut nicht aus dem Blick geraten", sagte die Leiterin der OECD-Abteilung für Sozialpolitik, Monika Queisser. "Es fehlt an einer systematischen Lösung der Altersarmut in Deutschland."
Für künftige Rentner gelte aber auch in anderen Nationen die Formel: "Länger arbeiten, mehr sparen." Die Wirtschaftskrise habe in der Mehrzahl der OECD-Mitgliedsländer Reformen der Alterssicherung beschleunigt. Fast überall sei das Renteneintrittsalter angehoben worden. 67 Jahre seien als Zielzahl inzwischen in den meisten Staaten Standard. Zugleich würden künftigen Rentnergenerationen fast überall nur noch niedrige Einkommen versprochen - auch um die Folgen des demografischen Wandels und der höheren Lebenserwartung für die Rentenkassen abzufedern.
Deutsche haben weniger Wohneigentum
Insgesamt gilt nach den Reformen in so gut wie allen Industrieländern, dass Menschen, die heute in den Arbeitsmarkt eintreten, später einmal mit einer geringeren Rente rechnen müssen. Durch einen längeren Verbleib im Erwerbsleben (Rente mit 67) kann laut OECD nur ein kleiner Teil dieser Verluste ausgeglichen werden.
Erstmals wurden bei dem alle zwei Jahre vorgelegten Vergleich auch Wohnungseigentum und Finanzvermögen bei der Alterssicherung berücksichtigt. Anders als in vielen Industriestaaten profitiert in Deutschland mit 50 Prozent nur ein verhältnismäßig kleiner Teil der Rentner vom eigenen Haus oder der Eigentumswohnung. Im OECD-Schnitt sind dies 76 Prozent. Das Kapitalvermögen der Ruheständler lässt sich international nur bedingt vergleichen. Nach OECD-Berechnungen kommen in Deutschland ähnlich wie in den meisten Staaten etwa 17 Prozent der Alterseinkünfte aus Kapitaleinkünften - meist privaten Zusatzrenten und Lebensversicherungen.
Union und SPD verhandeln in ihren Koalitionsgesprächen über die Einführung einer solidarischen Lebensleistungsrente. Dabei sollen die Rentenansprüche von Geringverdienern auf bis zu etwa 850 Euro aufgestockt werden. Voraussetzung sind 40 Beitragsjahre in der Rentenversicherung, wobei auch bis zu fünf Jahre Arbeitslosigkeit als Beitragsjahre gelten sollen. Für Minijobber bis 450 Euro - die dies nicht als Nebenjob und nicht als Schüler, Studenten oder Rentner machen - soll künftig die Rentenversicherungspflicht greifen. Die erst in diesem Jahr eingeführte Ausstiegsklausel wird demnach wieder abgeschafft.
Insgesamt sieht die OECD das deutsche Rentensystem aber auf einem guten Weg. Es sei finanziell vergleichsweise stabil. Außerdem sei die Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitnehmer kräftig gestiegen. So arbeiteten heute gut zehn Prozent der 65- bis 69-Jährigen - fast doppelt so viele wie vor zehn Jahren. "Deutschland hat hier eine Vorreiterfunktion", sagte Queisser.
Kein Jobaufschwung in Sicht
Arbeitsmarktforscher sehen derzeit keine Hinweise für einen neuen Jobaufschwung in Deutschland. "Trotz des positiven Konjunkturausblicks scheinen Verbesserungen bei der Arbeitslosigkeit im Moment noch nicht in Sicht zu sein", stellte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) fest.
Die Denkfabrik der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg beruft sich dabei auf das IAB-Arbeitsmarkt-Barometer, das mit einem November-Wert von 99,7 für die kommenden Monate einen ganz leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit signalisiert. Im Oktober hatte der Wert bei 99,6 Punkten gelegen, vor einem Jahr noch bei 97,9. Der Wert 100 bedeutet Stillstand auf dem Arbeitsmarkt, Werte darüber einen Rückgang der Erwerbslosenzahlen.
Das Job-Barometer bildet die aktuelle Bewertung der 256 deutschen Arbeitsagentur-Chefs ab. Sie werden monatlich dazu befragt, mit welcher Entwicklung des Arbeitsmarktes sie in ihrer jeweiligen Region in den kommenden drei Monaten rechnen. Gefragt wird nach der saisonbereinigten Arbeitslosigkeit.
Quelle: ntv.de, vpe/dpa/rts