Ex-Hilfssheriff als MarionetteKonzertierte Lügen-Kampagnen des Kreml fluten Netzwerke
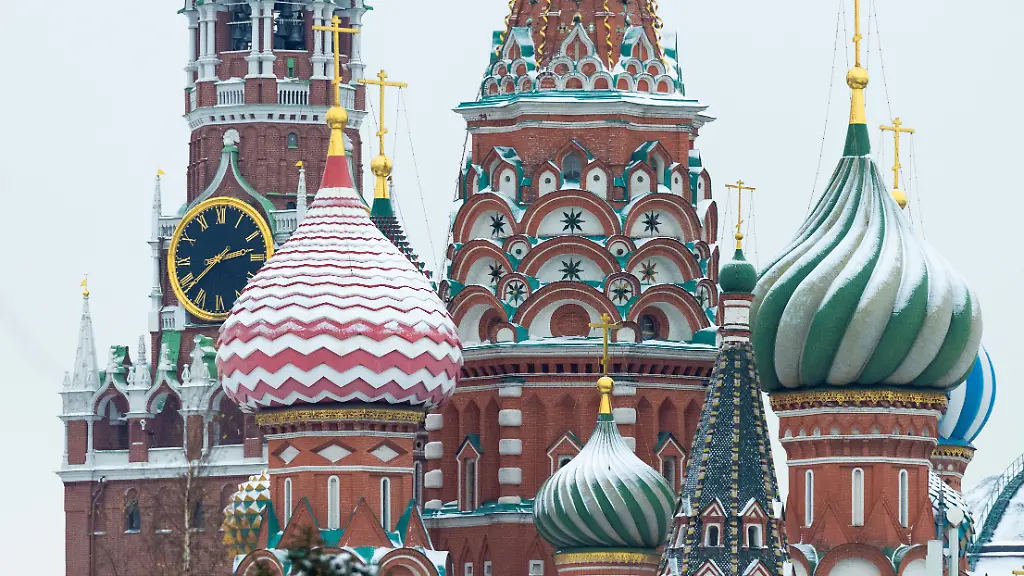
Russland hebt die Desinformation in den USA auf ein neues Level: "Narrative" nennen Forscher die durchgeplanten Kampagnen des Kreml. Der überschwemmt die sozialen Netzwerke mithilfe künstlicher Intelligenz, Schauspielern und bezahlten Influencern.
Zwei Tage nach der US-Präsidentschaftswahl beobachtet der Sozialwissenschaftler Darren Linvill, wie ein prominenter Verfechter Donald Trumps ein Video mit seinen 1,1 Millionen Followern auf X teilt. Es zeigt Uniformierte mit ukrainischen Abzeichen, die auf einen Dummy mit roter "Make America Great Again"-Kappe schießen und ihn anzünden. "Wir finanzieren keine Kriege in Ländern mehr, die Amerikaner hassen", steht dabei. "Donald muss aufräumen und ihm keine Steuergelder mehr schicken", kommentiert ein anderes Konto mit mehr als 500.000 Followern.
Das Video ist eine Fälschung, wie Linvill, Leiter des Zentrums für Medienforensik an der Clemson University in South Carolina, später klarstellen wird. Trotzdem wurde es bis Anfang November mehr als 30 Millionen Mal angesehen, schrieb die "Kyiv Post". Seit zwei Jahren beobachten Linvill und sein Forschungsteam, wie Moskau mit solchen Inhalten die Unterstützung für den Verteidigungskrieg der Ukraine gegen Russland zu untergraben versucht. "Alles hat sich seit 2016 verändert, vor allem bei den Russen", sagt Linvill im Interview mit ntv.de: "Es ist ein konstanter Strom."
Durch die sozialen Netzwerke kursiert eine ganze Schwemme manipulierter oder generierter Inhalte. Das Video mit den Uniformierten kommt höchstwahrscheinlich von inzwischen prominenter Stelle, eine russische Desinformationseinheit, die Microsoft Storm-1516 getauft hat. Diese Einheit allein habe bis kurz vor der US-Wahl mindestens "52 verschiedene Narrative" im Netz platziert, hat Linvills Team festgestellt. Weshalb wird solch ein Aufwand betrieben, was bezwecken die Macher mit ihren Falschbehauptungen und Lügen? Wo und von wem werden sie verbreitet? Hatten sie Einfluss auf das Wahlergebnis?
Vorneweg: Es ist kaum festzustellen, welchen direkten Effekt die Desinformationskampagnen auf das Wahlergebnis vor einem Monat hatten. Aber das Ziel wurde erreicht. Donald Trump wird der nächste Präsident der USA und die militärische Unterstützung Kiews steht nun auf höchst wackligen Füßen. Der Sieg des Republikaners ist somit im Interesse Moskaus, das seit fast drei Jahren mit einem enthemmten Angriffskrieg möglichst viel ukrainisches Territorium zu erobern versucht.
Die größten Lügenschleudern im Wahlkampf, das waren X von Elon Musk, der Trump im Wahlkampf unterstützte und dafür auch die Algorithmen anpasste, sowie Telegram und YouTube. Das Ziel der dortigen Attacken waren die Demokraten und insbesondere die Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und deren Vize Tim Walz. Noch einen Tag vor der Wahl, am 4. November, teilten der Direktor der US-Geheimdienste, das FBI und Cybersecurity-Behörde mit: "Russland ist die aktivste Bedrohung." Sie warnten auch vor noch umfassenderen Desinformationskampagnen nach dem Wahltag. Doch Trumps Sieg stand schon in der Wahlnacht so gut wie fest. Es blieb ruhig.
Breit geknüpftes Verbreitungsnetz
Schon vor acht Jahren hatte sich Russland in die Wahlen eingemischt, aber anders: über Troll-Konten und Werbung. Wie lief es diesmal ab? Zunächst veröffentlichten KI-Bots die Inhalte, mit technischen Hilfswerkzeugen erstellten Mitarbeiter gefälschte Websites en masse. Das über Jahre geknüpfte Verbreitungsnetzwerk brachte die manipulierten oder erfundenen Inhalte in Umlauf.
Videos für ihre erfundenen Geschichten drehten die Russen ihäufig mit Schauspielern und westafrikanischen Einwanderern auf den Straßen von St. Petersburg, sagt Linvill. Sie gäben sich als Insider oder Opfer aus, die ihre Geschichte erzählen, ihre Gesichter würden mit Software verändert. Aus den Videos entstehen demnach die Artikel für Fake-Nachrichtenseiten, die echten nachempfunden sind. Sie heißen "DC Weekly", "New York News Daily" oder "The London Crier". "Das hätte man früher mit unglaublich großen Mengen an Ressourcen auch machen können, aber es wäre viel, viel teurer gewesen", so Linvill.
Die Websites werden laut US-Medien und Experten federführend von einem ehemaligen US-Hilfssheriff erstellt: John Mark Dougan. Er war jahrelang im Bezirk Palm Beach angestellt; dort befindet sich auch Trumps Anwesen Mar-a-Lago. Dougan wird in seiner Heimat wegen Vergehen im Job gesucht, inzwischen hat der US-Amerikaner auch die russische Staatsbürgerschaft. Experten glauben, Dougan sei nur ein Spielstein; ein williger, vorgeschobener Kopf, über den anstelle der wahren Drahtzieher berichtet werden soll.
Die Russen platzieren ihre Geschichten zudem für ein paar Dollar auf echten Nachrichtenseiten in afrikanischen oder arabischen Ländern. Dann kommen die Influencer aus Russland und anderswo, die sie verbreiten. Es sind Stimmen, denen auch in den USA viele Menschen zuhören. Ein bekannter Fall: Laut Anklage des US-Justizministeriums bezahlte Moskau im Wahlkampf mindestens 10 Millionen US-Dollar an prominente konservative Influencer, um Inhalte zu vermitteln. Die nehmen die Jobs an und lassen die Grenzen zwischen Desinformation und Parteilichkeit verschwimmen.
Das Ziel der Aktionen ist weniger die direkte Beeinflussung einer Wahl, sondern Misstrauen in Medien und die Demokratie zu erzeugen. Schon dass über etwas geredet wird, hat einen Effekt: Manche Menschen fangen an, zu zweifeln. Und sobald Wähler denken, sie könnten Mainstream-Medien nicht mehr glauben, wenden sie sich womöglich von ihnen ab. Deren Rolle nehmen Influencer, Podcaster und Meinungsmacher ein, die wesentlich einfacher beeinflussbar sind als ein Unternehmen oder öffentlich-rechtliche Medien.
Organisation von Ex-Wagner-Chef Prigoschin
Hinter Dougan und im Zentrum der russischen Desinformationskampagne bei der US-Präsidentschaftswahl befindet sich laut Linvills Ergebnissen die "Russian Foundation for Battling Injustice" (R-FBI) - die sogenannte Russische Stiftung zur Bekämpfung der Ungerechtigkeit. Gegründet wurde die Organisation von Jewgeni Prigoschin, dem früheren Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, im Jahr 2021.
Die R-FBI stellt sich selbst als Menschenrechtsorganisation dar; die Bezeichnung ist nicht mehr als ein Feigenblatt, denn die Methoden sind ähnlich wie die von Prigoschins früherer Troll-Farm "Internet Research Agency". Die hatte Trump ab Dezember 2015 unterstützt und versucht, die US-Wahl 2016 zu dessen Gunsten zu beeinflussen. Jahre später klagte deshalb eine US-Jury 13 Russen und drei Organisationen an. Sie hätten versucht, "die Wahl und politische Prozesse" zu beeinflussen. Prigoschin starb im August 2023 bei einem Flugzeugabsturz, zwei Monate nach einem versuchten Putsch gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Die Internet Research Agency wurde aufgelöst.
Weitere große Lügenschleudern waren im Wahljahr die Republikaner und ihre Unterstützer selbst. Ein prominentes Beispiel: Mindestens 87 falsche oder irreführende Aussagen von Elon Musks eigenem X-Konto wurden vor der Wahl insgesamt 2 Milliarden Mal angesehen, stellte das Center for Countering Digital Hate fest.
Auch Trump selbst verbreitete Lügen. In seiner Fernsehdebatte gegen Kamala Harris behauptete er eindringlich, haitianische Einwanderer äßen Hunde und Katzen. Das stimmt nicht, und nach dem TV-Duell sagten in einer Umfrage fast zwei Drittel, die Demokratin habe die Debatte gewonnen. Doch was blieb, waren wochenlange Diskussionen über Einwanderer - ganz im Sinne der Republikaner. Deren Kandidat behauptete nach dem zerstörerischen Hurrikan "Helene" zudem, dass Hilfsgelder an Immigranten ohne Aufenthaltsgenehmigung gingen. Auch das war falsch, der Ex-Präsident verbreitete es trotzdem.
Trump und andere Republikaner behaupten zudem immer wieder, mit Einwanderung kämen überproportional viele Kriminelle ins Land. Das ist höchst zweifelhaft. Im Bundesstaat Texas etwa hatten sich US-Amerikaner zwischen 2012 und 2018 dreimal so häufig strafbar gemacht wie Einwanderer ohne Aufenthaltsgenehmigung, analysierte das Justizministerium. Ein möglicher Grund war die Angst, abgeschoben zu werden; unter Präsident Barack Obama wurden so viele Menschen ins Ausland gebracht wie nie.
"Kann mir kaum vorstellen, wo wir in vier Jahren stehen"
Während der Wahl wurden auch verschiedene manipulierte Fotos und generierte Bilder in Umlauf gebracht, die Kamala Harris in zärtlichen Situationen mit dem bekannten Sex-Straftäter Jeffrey Epstein zeigten. In einem weiteren Fake-Video aus russischer Hand behauptete ein angeblicher Haitianer, er sei gerade erst in die USA eingereist und habe in zwei Schlüsselwahlkreisen gewählt. Weitere Lügengeschichten bezichtigten Harris der Fahrerflucht, das Unfallopfer sei nun gelähmt.
Eine der bekanntesten Falschnachrichten jedoch ging über Harris' Vizekandidat viral: Ein angeblicher ehemaliger Schüler warf Tim Walz in einem Video sexuellen Missbrauch vor. Auch dieses Video soll von Storm-1516 stammen. Dies sei nur "ein Stück im russischen Desinformationspuzzle mit vielen Einheiten", sagt Linvill. Wie sich dieses Puzzle bis zur kommenden wichtigen Wahl zusammensetzen wird? "Vor vier Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, wo wir heute stehen", sagt der Wissenschaftler. Die Macher setzen KI ein, Websites, erstellen Videos, arbeiten mit Influencern. "Ich kann mir kaum vorstellen, wo wir in vier Jahren stehen."