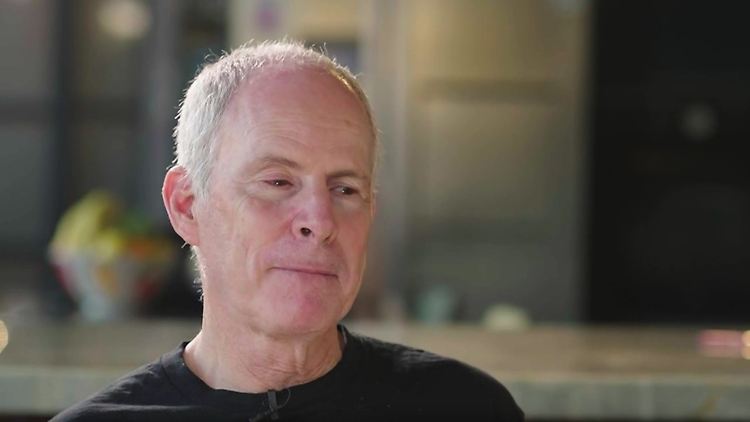Im Schatten von King Robert Schotten rütteln am britischen Haus
10.02.2012, 09:45 Uhr
Wagen die Schotten den Schritt in die Unabhängigkeit?
(Foto: REUTERS)
Der schottische Freiheitsgeist lebt: Spätestens seit dem überwältigenden Wahlsieg der Scottish National Party 2011 ist klar, dass es in Großbritannien in den nächsten Jahren unruhiger wird. Der Erste Minister Salmond will seinen Traum von einem unabhängigen Schottland verwirklichen. Der Bruch mit dem größeren England ist für ihn "fast unausweichlich".
"Oh Blüte Schottlands, wann werden wir Euresgleichen sehen. Die Ihr kämpftet und gestorben seid, für Euer kleines bisschen Hügel und Tal; und getrotzt haben des stolzen Edwards Heer, und ihn heimwärts schicktet, dass er sich's noch einmal überlege", lautet der Text der ersten Strophe des patriotischen Liedes "The Flower of Scotland". Dieses ist nur eine von drei inoffiziellen schottischen Nationalhymnen - die beiden anderen sind "Scotland the Brave" und "Scots Wha Hae". Es ist Pflicht, dass Akteure von schottischen Fußball- und Rugbymannschaften vor jedem Spiel voller Inbrunst dieses Lied schmettern. Die eigentliche britische Nationalhymne "God save the Queen" bleibt bei Veranstaltungen dieser Art den Engländern vorbehalten.
Die Schotten - auch "Bravehearts" genannt - sind ein stolzes Volk. Die Engländer können ein Lied davon singen. So leisten sie sich zum Beispiel im Fußball nicht nur eine eigene Nationalmannschaft, sondern im Gegensatz zu den Walisern auch eine eigene Fußballliga und nehmen damit in Kauf, mit ihren beiden Glasgower Meisterklubs Celtic und Rangers chancenlos der internationalen Konkurrenz ausgeliefert zu sein. Obwohl der nördliche Landesteil Großbritanniens nur etwas mehr als fünf Millionen Menschen hat und eine Fläche von lediglich rund 79.000 Quadratkilometer aufweist - das entspricht rund drei Viertel der Fläche der ehemaligen DDR - gerät er immer mehr ins Blickfeld der europäischen Politik. Denn es ist nicht mehr völlig unwahrscheinlich, dass in die Völkerfamilie aufgenommen wird.
Folgendes Szenario ist möglich: Am 1. Januar 2017 wird in Edinburgh in einem Staatsakt die vollständige Unabhängigkeit Schottlands von Großbritannien vollzogen. Der Erste Minister Alex Salmond wird Premierminister und bleibt - wie auch in Kanada oder Australien - offizielles Staatsoberhaupt. Der 1707 geschlossene "Act of Union", der die politische Vereinigung der Königreiche England und Schottland festschreibt, verliert seine Gültigkeit. Zu den Feierlichkeiten ist aus London David Cameron angereist, der damit der letzte Premierminister Großbritanniens sein wird. Auch Vertreter von EU-Kommission und Nato sind zugegen, weil Schottland gleichzeitig von beiden Organisationen als neues Mitglied aufgenommen wird. Gleichzeitig erwägen die Schotten einen Antrag zur Aufnahme in die Eurozone. Weil man sich mit London nicht über eine zwischenzeitliche gemeinsame Währungsunion einigen kann, gilt das neu geschaffene Schottische Pfund als Währung. Amtssprache bleibt weiter Englisch, aber die in weiten Teilen des Landes praktizierte schottisch-gälische Sprache wird zunehmend gefördert - der Staatsname "Alba" wird so an Bedeutung gewinnen. Schauspieler Sean Connery - mittlerweile 86 Jahre alt - hat während der Unabhängigkeitszeremonie Tränen in den Augen. Die aus Glasgow stammende Band Simple Minds spielt "The Flower of Scotland". Cameron, der nur noch Machtbefugnisse über England, Wales und Nordirland hat, betreibt den Austritt aus der EU, der kurze Zeit später vollzogen wird. Der Rest Großbritanniens wird in Britannien umbenannt. Die 90 Jahre alte Queen darf aber weiter mit ihrer Familie ihre Sommerferien auf ihrem schottischen Schloss Balmoral verbringen.
Salmonds Bannockburn-Offensive
Das ist natürlich fiktiv, denn noch ist völlig unklar, ob es überhaupt zu einer Abspaltung Schottlands vom Vereinigten Königreich kommt. Aber ein Referendum - das nach schottischer Darstellung allerdings nicht bindend sein soll - zur Unabhängigkeit des zweigrößten britischen Landesteils wird es auf jeden Fall geben. , sucht nach eigenen Angaben einen konstruktiven Dialog mit Cameron oder dessen Stellvertreter in Edinburgh oder in London oder wo auch immer. Der 57-Jährige, der seit Langem von der Eigenständigkeit seines Landes träumt, kann sich allerdings zum jetzigen Zeitpunkt der Mehrheit seiner Schotten bei dem Referendum nicht sicher sein. Deshalb gibt es Streit mit der konservativ-liberalen Regierung in London, die , wohl wissend, dass Salmond sie mit großer Wahrscheinlichkeit verlieren wird. Umfragen vom Herbst 2011 zufolge ist nur rund ein Drittel der Schotten für die völlige Trennung von England. Die Mehrheit will derzeit kein vollständig unabhängiges, sondern ein ökonomisch freies Schottland. Und darauf spekuliert Cameron, der ein Auseinanderdriften Großbritanniens unbedingt verhindern will.
Dennoch hält der schottische Regierungschef an seinem Vorhaben fest: Der Bruch mit dem größeren England sei für ihn "fast unausweichlich", äußerte er. Deshalb bringt der studierte Historiker Salmond die Geschichte ins Spiel. Er will das Referendum erst 2014 stattfinden lassen. In diesem Jahr begeht Schottland den 700. Jahrestag der legendären Schlacht von Bannockburn, in der die von Robert the Bruce angeführten Truppen die zahlenmäßig überlegenen englischen Streitkräfte des in der Hymne erwähnten Königs Edward II. schlugen. Dieser auf sumpfigem Gelände errungene Sieg machte den Weg für den Friedensvertrag von Edinburgh 1328 frei, mit dem die Engländer die Unabhängigkeit Schottlands offiziell anerkannten. Die Statue von Robert the Bruce auf dem Feld von Bannockburn ist für Salmonds SNP ein Wallfahrtsort. Jährlich legen die Separatisten dort einen Kranz nieder.
Natürlich stößt Salmonds Plan in der Londoner Downing Street auf wenig Gegenliebe. Cameron sieht die Gefahr, dass ihm die Schotten im Schwange nationalen Hochgefühls vom Union Jack gehen könnten. Seine Tories führen im schottischen Parlament ein Nischendasein - bei der Regionalwahl 2011 bekamen sie nur 12,4 Prozent der Stimmen. Die Konservativen sind bei den Schotten seit den Thatcher-Jahren unten durch, weil die "eiserne Lady" in den 1980er Jahren in Schottland "wütete" und in großer Zahl unrentabler Betriebe schließen ließ. Ein dramatischer Anstieg der Arbeitslosigkeit war die Folge.
Somit sind die Fronten in dieser für die Einheit Großbritanniens wichtigen Frage verhärtet - zumal die Konservativen in London regieren. Es gibt zudem einen juristischen Streit darüber, ob die schottischen Abgeordneten überhaupt eine Volksabstimmung anordnen dürfen. Der sogenannte "Scotland Act", der die Rechte und Aufgaben des Parlaments in Edinburgh festlegt, sieht vor, dass Verfassungsreformen und Volksvoten der britischen Regierung vorbehalten sind. In London und in der schottischen Hauptstadt rauchen bereits die Juristenköpfe. Zudem sitzen im Londoner Unterhaus auch schottische Abgeordnete, die über Belange Englands, das kein eigenes Parlament besitzt, mitentscheiden. Die Schotten können - als Beispiel sei Gordon Brown genannt - sogar das Amt des britischen Premierministers ausüben.
Sorge um den Lebensstandard
Bereits jetzt hat das schottische Parlament weitreichende Befugnisse. Der unter der Labour-Regierung von Tony Blair 1998 verabschiedete "Scotland Act" billigt Edinburgh die Entscheidungsgewalt in wichtigen Bereichen wie Bildung, Gesundheit, Landwirtschaft und Justiz zu. Dagegen regelt London die Ressorts Außenpolitik, Verteidigung, Wirtschaft und Finanzen. Diese will Salmond voraussichtlich auch an sich reißen.
Damit stößt er aber bei einem nicht unerheblichen Teil seiner Landsleute auf Widerstand. Denn gerade den Schotten wird nachgesagt, dass sie - vorsichtig ausgedrückt - gut rechnen können. Viele von ihnen befürchten im Fall einer vollständigen Unabhängigkeit ein Absinken des Lebensstandards. Schottland ist ökonomisch deutlich schwächer als der Nachbar im Süden mit seinen mehr als 50 Millionen Einwohnern. Schottland besitzt kaum nennenswerte Industrie, die Arbeitslosenquote liegt über dem britischen Durchschnitt. Zwar wird die Computersoftware als Hauptexportprodukt angegeben und auf die Öl- und Gasvorkommen in der Nordsee verwiesen. Allerdings ist das "schwarze Gold" nur in begrenztem Maße vorhanden, so dass man sich schon seit geraumer Zeit in London den Kopf darüber zerbricht, wie die Zeit nach dem Öl gestaltet werden soll. Außerdem ist es unwahrscheinlich, dass den Schotten die im Raum stehenden 90 Prozent der britischen Erlöse aus diesem Geschäft alleine in Anspruch nehmen können. Bliebe für Schottland noch die weltberühmte Whisky-Industrie, die aber keine zusätzlichen Arbeitsplätze schafft. Und weil sie eben rechnen können, fürchten die Schotten um die umfangreichen Transferzahlungen, die von der Themse aus in Richtung Norden fließen.
Salmond - er hat auch Volkswirtschaftslehre studiert - hat dies erkannt und spielt deshalb seit geraumer Zeit die europäische Karte. . Seiner Meinung nach hat der Premier einen schweren Fehler begangen. Um dem Ganzen noch mehr Ausdruck zu verleihen, tat Salmond dies in einem offenen Brief kund. Im Gegensatz zu seinem Kollegen in London strebt der Schotte gute Beziehungen zu Brüssel an, denn sein Land profitiert von den EU-Milliarden und Salmond hofft, im Fall einer Unabhängigkeit noch mehr Geld zu bekommen.
Somit ist das angestrebte schottische Referendum nicht nur ein britisches Problem, sondern auch ein europäisches. Eine Unabhängigkeit Schottlands würde nicht nur die politische Landkarte verändern, sondern auch zu einer Verschiebung der Kräfte innerhalb der EU führen - und dies, obwohl Cameron Großbritannien bereits schon an den äußersten EU-Rand geführt hat. Und Brüssel hätte mit Edinburgh ein weiteres finanzielles Problem auf dem Tisch.
"Schlagt die stolzen Thronräuber nieder! Tyrannen fallen mit jedem Feind! Freiheit ist in jedem Hieb! Lasst es uns tun, oder sterben!", heißt es in der letzten Strophe von "Scots Wha He". Diese martialischen Zeiten sind auf der Insel glücklicherweise vorbei. Auch wenn Schottland ein Teil Großbritanniens bleibt: Die Dudelsäcke werden weiterhin erklingen, und die Prinzen Philip - er ist immerhin der Duke von Edinburgh - und Charles tragen auf Balmoral Castle nach wie vor einen Kilt.
Quelle: ntv.de