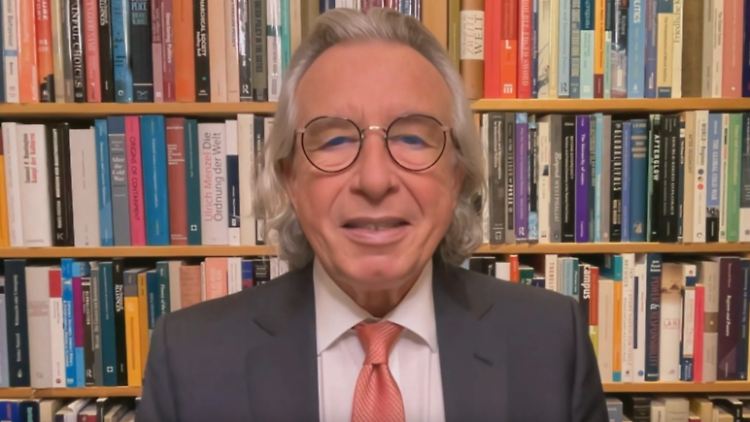Das Ende des Verbrennungsmotors So ist 2030 machbar
24.06.2017, 12:28 Uhr
Nicht immer einer Meinung: der linke Anton Hofreiter (l.) und der Realo Winfried Kretschmann.
(Foto: picture alliance / dpa)
Eine heimliche Videoaufzeichnung zeigt, wie sich der grüne Ministerpräsident Kretschmann über ein Ziel der eigenen Partei aufregt: das Aus des Verbrennungsmotors 2030. Jetzt reagiert Grünen-Fraktionschef Hofreiter.
Die Automobilindustrie wird in den nächsten Jahren einen radikalen Veränderungsprozess durchlaufen. Die Politik in Deutschland steht daher vor einer entscheidenden Frage: Versuchen wir wie die Bundesregierung weiterhin einen Schutzzaun um die Diesel- und Ottomotoren zu ziehen, um eine Technik aus dem 19. Jahrhundert noch ein paar Jahre zu verlängern? Oder setzen wir uns an die Spitze der globalen Bewegung, damit auch in Zukunft das Auto in Deutschland entwickelt und produziert wird?
Die Chancen neuer Mobilität sind groß: saubere und leise Innenstädte, Klimaschutz, keine Abhängigkeit vom Öl mehr, der Erhalt industrieller Wertschöpfung und der Jobs in Deutschland, die daran hängen. Zugleich ist die Aufgabe gigantisch. Die Automobilindustrie ist Deutschlands wichtigste Wirtschaftsbranche und sie ist bisher dem fossilen Verbrennungsmotor verhaftet. Und es klingt ja auch schwer vorstellbar. So sehr wir uns an Benzin- und Dieselmotoren gewöhnt haben, so selbstverständlich scheint uns diese Form des Automobils. Über 45 Millionen PKW fahren heute auf den deutschen Straßen. Weit über eine Milliarde Kraftfahrzeuge weltweit.

Anton Hofreiter ist Fraktionschef der Grünen. Zuvor machte sich der studierte Biologe als Vorsitzender des Verkehrsausschusses des Bundestages einen Namen.
(Foto: picture alliance / dpa)
Und nun fordern wir Grüne, den fossilen Verbrennungsmotor langsam abzuschaffen und haben dafür eine klare Zielmarke gesetzt. Ab 2030 wollen wir nur noch emissionsfreie Autos neu zulassen. Union, SPD, FDP sind dagegen, der Verband der Automobilindustrie sträubt sich.
Und auch unser grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat an dieser Jahreszahl Zweifel angemeldet. Diese Differenz ist nichts Schlimmes. Winfried Kretschmann ist Ökologe und gerade er hält die ökologische Modernisierung unserer Wirtschaft für die grüne Kernaufgabe. In Baden-Württemberg setzt er sich energisch und mit voller Kraft für eine ökologische und nachhaltige Automobilwirtschaft ein. Und wo, wenn nicht bei den Grünen ist programmatischer Streit zu Hause. Wir Grüne führen hier eine zentrale klima- und industriepolitische Debatte stellvertretend für die Gesellschaft. Das ist allemal besser, als den Kopf in den Sand zu stecken, wie es die anderen Parteien tun.
Ich will auf seine Zweifel und die vieler anderer antworten. Denn wir haben uns sehr ausführlich, intensiv und ernsthaft mit der Frage der Machbarkeit einer solchen industriepolitischen Strategie beschäftigt. Viele Experten haben sich bereits in diesem Sinne geäußert, so etwa der renommierte Automobilexperte Prof. Ferdinand Dudenhöfer, Verkehrsforscher wie Professor Andreas Knie, Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesumweltministerium und Rainer Baake, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Der Ausstieg aus dem klimafeindlichen und gesundheitsschädlichen Verbrennungsmotor ist technisch machbar, er ist klimapolitisch unerlässlich und ist industriepolitisch enorm wichtig für Deutschland.
Deutschland hängt weit hinterher
Dazu braucht es aus drei Gründen einen klaren ordnungspolitischen Rahmen. Erstens: Deutschland hat im Pariser Klimaabkommen zugesagt, seinen Verkehrssektor bis zum Jahr 2050 treibhausgasneutral zu gestalten. Dazu ist es erforderlich, nach 2030 keine neuen PKW mit fossilen Verbrennungsmotoren mehr neu zuzulassen. Denn im Durchschnitt sind PKW in Deutschland 18 Jahre auf der Straße unterwegs.
Zweitens: Planungssicherheit für die Unternehmen. Investitionen erfordern verlässliche Rahmenbedingungen. Bisher stagniert der Absatz von E-Autos in Deutschland. Die Bundesregierung hat ihr eigenes Ziel, bis 2020 eine Million Elektroautos auf die Straße zu bringen, bereits in den Wind geschrieben. Verständlicherweise zögern deshalb viele Hersteller, sich mit voller Kraft auf die E-Mobilität oder andere alternative Antriebe einzulassen. Diese Unsicherheit beenden wir nur mit einem klaren politischen Rahmen. Damit können die Unternehmen kalkulieren, die Blockaden und das Zaudern haben ein Ende.
Drittens: Der globale Megatrend zur Elektromobilität ist unabweisbar, und er läuft bereits heute. Das zeigt sich an den neuen Konkurrenten wie dem amerikanischen Autobauer Tesla oder dem chinesischen Konzern BYD. China führt eine E-Quote ein, Indien will ebenfalls 2030 ohne fossilen Verbrennungsmotor auskommen. Wer die giftgetränkte Luft in den chinesischen oder indischen Megastädten schon einmal atmen musste, der versteht, warum gerade diese Staaten zu Vorreitern der Entwicklung werden. Sie sind heute übrigens noch zentrale Absatzmärkte für die deutsche Automobilindustrie. Mit Norwegen ist ein Industrieland bereits weit fortgeschritten. 40% der Neuzulassungen sind 2017 elektrisch. Deutschland hängt dagegen weit hinterher. Eile ist geboten, nicht nur aus Klimaschutzgründen, sondern gerade auch, um das Abwandern von Wertschöpfung und Arbeitsplätzen zu verhindern.
Für E-Autos brauchen wir keine zentralen Tankstellen
Völlig klar ist: Dieses Ziel lässt sich nicht erreichen, wenn wir bis dahin die Hände in den Schoß legen. Es braucht eine umfangreiche politische Begleitung. Die Ladeinfrastruktur muss ausgebaut, die Forschung unterstützt werden. Zwischenziele über ambitionierte CO2-Grenzwerte auf europäischer Ebene bereiten den Umstieg vor. Und mit neuen Kaufanreizen muss die Nachfrage in Gang gebracht werden.
Natürlich nehmen wir Grüne die Zweifel, die es an diesem Umbau im Allgemeinen und an der E-Mobilität im Speziellen gibt, sehr ernst. Bei der E-Mobilität sind schwierige Herausforderungen zu bewältigen, was Ladepunkte, technologische Reife, Reichweite, Preise und die ökologische Gesamtschau angeht. Aber auf all diese Fragen gibt es gute Antworten.
Nur, wenn ein leicht nutzbares, flächendeckendes Netz zum Laden entsteht, verschwindet die Angst vor der mangelnden Reichweite. Nur dann können E-Autos sich durchsetzen. Die gute Nachricht: Für E-Autos brauchen wir keine zentralen Tankstellen. Wir können vielfältige dezentrale Ladepunkte nutzen, digitalisiert, effizient, nutzerfreundlich. Jeder Parkplatz, jede Garage kann zu einer kleinen E-Tankstelle werden. Auch an Supermärkten und öffentlichen Einrichtungen gibt es schon jetzt immer öfter Parkplätze, an denen geladen werden kann. Entlang von Autobahnen entsteht ebenfalls ein immer dichteres Netz von Schnellladesäulen. Mittlerweile haben sich sogar Daimler, BMW, VW und Ford in Deutschland zusammengeschlossen und wollen selbst Schnellladesäulen errichten. E-Laden kann somit auf absehbare Zeit einfacher sein als Tanken. Wie es gehen kann, zeigen schon heute die Niederlande: Dort gab es 2015 bereits mehr als doppelt so viele Ladestationen wie in Deutschland, obwohl das Land nur etwas größer als Nordrhein-Westfalen ist. Wir müssen unverzüglich die rechtlichen Möglichkeiten für E-Ladesäulen und die Bezahlsysteme vereinfachen. Und wir müssen massiv in den Ausbau der Ladeinfrastruktur investieren.
Bei Technologie und Kosten abgasfreier Mobilität sind die Fortschritte der letzten Jahre rasant. Zahlreiche Autohersteller bieten bereits vollfunktionale E-Autos mit akzeptabler Reichweite an. Neben Tesla gibt es auch viele europäische Modelle, etwa den BMW i3, den Renault Zoe, den Opel Ampera. Auch die Fortschritte bei den Batterien sind gigantisch: Alle zwei bis drei Jahre verdoppelt sich die Energieleistung pro Kilo Gewicht. Die Kosten für Batteriepacks könnten sich bis 2020 oder 2025 mehr als halbieren. Da fossile Verbrennungsmotoren durch die aufwändige Abgasreinigung immer teurer werden, gleichen sich die Preise in den nächsten Jahren wahrscheinlich schnell an. Die baden-württembergische Prestigemarke Porsche will bereits in sechs Jahren jeden zweiten Porsche mit einem elektrischen Antrieb verkaufen. Im Jahr 2023.
Zukunft wird aus Mut gemacht
Und die ökologische Gesamtbilanz? Ein E-Auto, das mit Kohlestrom fährt, ist ökologisch keine gute Idee. Eines, das mit Sonne und Wind betankt wurde, schon. Entscheidend ist deshalb, dass Energie- und Verkehrswende Hand in Hand gehen. Das ist sehr wohl möglich. Das Ökoinstitut hat errechnet, dass bei einem Bestand von sechs Millionen Elektroautos eine zusätzliche Stromnachfrage von etwa elf Terrawattstunden entsteht. Dies entspricht etwa zwei Prozent des heutigen Gesamtstromverbrauchs in Deutschland. Je länger man sich damit beschäftigt, desto optimistischer und begeisterter kann man werden.
Entscheidend für die Öko-Bilanz ist aber auch ein gutes Recyclingsystem für Batterien. Hier gibt es noch Fragen zu beantworten und Aufgaben für die Forschung. Und klar ist auch: Der Umstieg zu E-Autos muss begleitet werden durch eine andere Mobilitätspolitik. Elektroautos mit hoher Speicherkapazität und eher geringen Einsätzen sind ökologisch fragwürdig. Deswegen ist es sinnvoll, E-Autos etwa als Taxis, Lieferwagen und Carsharing-Fahrzeuge besonders zu fördern. Und parallel den öffentlichen Personennahverkehr, die Bahn und den Radverkehr als Alternativen zum Auto massiv auszubauen.
Die Forderung nach einem Aus des fossilen Verbrennungsmotors 2030 ist ambitioniert, aber es ist technisch machbar, es lohnt sich und die Zeit drängt. Wer, wie die Bundesregierung, auf Zeit spielt, gefährdet den Klimaschutz, er gefährdet aber vor allem auch Arbeitsplätze und Wohlstand.
In einer Welt im Wandel braucht es Weitsicht und Mut zu Reformen. Der Pionier des Autos in Deutschland, Gottfried Daimler, prognostizierte 1901: "Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren." Er behielt Unrecht und schrieb dennoch deutsche Wirtschaftsgeschichte. Zukunft wird aus Mut gemacht.
Quelle: ntv.de