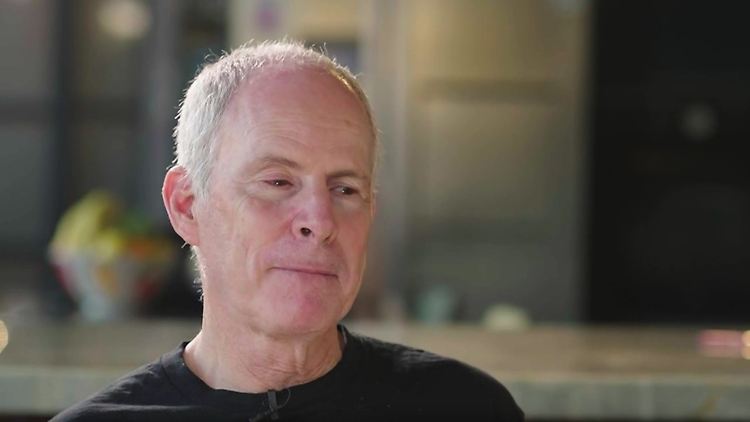Mappus hat sich verzockt Stuttgart fährt Regierungschef herunter
25.03.2011, 06:41 Uhr
Mappus hat seinen Deal am Landtag vorbei eingefädelt.
(Foto: picture alliance / dpa)
Kurz vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg gerät Ministerpräsident Mappus immer stärker in Erklärungsnot. Der Grund: der verpatzte Wiedereinstieg des Landes beim Energiekonzern EnBW. Der Deal wird für Mappus zum Klotz am Bein und verleiht der Opposition Flügel.
Glaubt man den letzten Umfragen, dann wird sich der baden-württembergische Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) ab kommender Woche einen neuen Job suchen müssen. Schuld daran ist Mappus selbst. "Er war kein guter Landesvater", meinte Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) unlängst in einem Interview. Er sei in seiner Funktion als Regierungschef eher ein Machtmensch gewesen, als dass er zu lenken gewusst habe.
Auch wenn Palmer als Grüner naturgemäß dem CDU-Politiker nicht allzu wohlgesonnen sein dürfte, trifft doch seine Charakterisierung Mappus' als Machtmenschen den Nagel auf den Kopf. Tatsächlich gehören Aussagen wie "finale Lösung" nicht nur zu Mappus' Wortschatz, sondern auch zu seiner speziellen Art, Politik verstanden zu wissen. Abgeschaut von seinem hessischen Vorbild Roland Koch, witterte er nach seinem holprigen Start im Sommer 2010 die Chance, sich in den konservativen Landstrichen als Hüter von Recht und Ordnung zu profilieren. Der Streit um Stuttgart 21 kam ihm zunächst ganz recht und die Bloßstellung seiner Gegner sollte die Kernwählerschaft im Ländle mobilisieren. Mappus prägte den Begriff von den "Berufsdemonstranten am Bahnhof". Theatralisch rief er seinen Anhängern zu, er nehme den "Fehdehandschuh" auf, den man ihm hingeworfen habe. Er unterstellte den Demonstranten im Stadtpark und am Bahnhof eine zunehmende Gewaltbereitschaft und beschwor die Gefahr eines Regierungssturzes. Auch Stuttgart 21 und die Landtagswahl wollte er "final lösen". Am Ende gingen nach dem Einsatz von Wasserwerfern und Pfefferspray gegen Demonstranten die "blutigen Augen von Stuttgart" als Bilder um die Welt.
Aber zu Roland Kochs Eigenschaften gehörten auch die Phasen der Demut. Diese sind Stefan Mappus bislang fremd. Dafür hatte Mappus Glück. Seine Gegner im Streit um den Stuttgarter Bahnhof rüsteten ab und bekannten sich zum friedlichen Weg der Schlichtung. Mappus konnte aufatmen, er hatte die bislang schwierigste Phase seiner Amtszeit überstanden. Vor ihm lag jetzt die große Herausforderung, sich den Sieg bei der bevorstehenden Landtagswahl zu sichern. In der logischen Denkfolge des Machtmenschen Mappus musste jetzt ein echter Coup her: Die Krone sollte der Rückkauf der EnBW-Aktien des französischen Staatskonzerns EDF werden, den Mappus am Nikolaustag 2010 besiegelte und über den er seinen eigenen Finanzminister Willi Stächele erst gegen 23 Uhr des Vorabends informierte.
Für den 45-Prozent-Anteil hat Mappus knapp 5 Milliarden Euro gezahlt. Der Rückzug aus der Kernenergie und der beschleunigte Umstieg auf erneuerbare Energien bedeutet für EnBW zunächst aber eine finanzielle Belastung - von Gewinn kann keine Rede mehr sein. "Der Stromkonzern steht vor einer Durststrecke", musste der FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke eingestehen. Auch der Bund der Steuerzahler sieht den Kauf der EnBW-Anteile über Schulden kritisch. "Jetzt dürfte sich der Aktienkurs deutlich nach unten bewegen, damit steigt das Risiko für den Steuerzahler", sagte Wilfried Krahwinkel, Landeschef des Steuerzahlerbundes. Experten erwarten einen Wertverlust des EnBW-Aktienpaketes, der dem Land 500 Millionen Euro oder mehr kosten könnte.
Die Mär von den Heuschrecken
Der Deal, den Mappus in aller Eile am Parlament vorbei durchzog, wird den sparsamen Schwaben und all den anderen Ländle-Bewohnern noch jahrelang schwer im Magen liegen. An einen Verkauf der EnBW-Anteile ist erst gegen Ende der nächsten Legislaturperiode, also frühestens 2016, zu rechnen. Dabei wollte Mappus den Erfolg ganz für sich allein. Den Landtag stellte er vor vollendete Tatsachen. Gefahr sei in Verzug gewesen, ausländische Heuschrecken hätten die Anteile kaufen wollen, so Mappus' Argumentation. Er beruft sich schließlich auf den Notstandsparagrafen.

Kretschmann und Schmid wollen EnBW zu einem grünen Vorzeigeunternehmen machen.
(Foto: picture alliance / dpa)
"Die Mär von den Heuschrecken glaubt niemand mehr", ist sich der möglicherweise nächste Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, sicher. Der , dass Mappus' Argument von der großen Eile "völlig lächerlich" sei, weil es ein Vorkaufsrecht der oberschwäbischen Elektrizitätswerke und der Landkreise (OEW) gegeben habe. Mappus habe sich als führungsstarker Macher profilieren wollen, der den Wirtschaftsstandort sichere. Und den Erfolg habe er ganz für sich allein haben wollen, so Kretschmann. "Das, was Mappus als Gefahren ins Feld führte und unter das er seine rechtskräftige Unterschrift setzte, war in Wirklichkeit nur Wahlkampf." Bis heute existiere kein Hinweis darauf, dass überhaupt jemand eine Übernahme plante. "Außer Mappus vielleicht."
Ein "typisches Beispiel von Spätzlewirtschaft", schimpft die Stuttgarter Opposition, der bei dem Mappus-Deal nur die Zuschauerrolle blieb. Selbst seinen Finanzminister Willi Stächele informierte Mappus erst wenige Stunden vor der Vertragsunterzeichnung. Der CDU-Ministerpräsident teilte seinem Ressortchef etwas mit, was bis dahin höchstens eine Handvoll Eingeweihte wussten: Das Land werde 45 Prozent des Karlsruher Energieversorgers EnBW vom französischen Staatskonzern EDF kaufen. Und: Der Vertrag werde schon am nächsten Tag, am 6. Dezember 2010, unterzeichnet. Stächele hatte keine Gelegenheit mehr, sich mit dem Geschäft vertraut zu machen.
Der 44-jährige Ministerpräsident wollte das Milliarden-Geschäft so geräuschlos wie möglich über die Bühne bringen - denn schließlich sollten die viel beschworenen Heuschrecken nicht die Möglichkeit bekommen, den Aktienkurs vor dem Kauf in die Höhe zu treiben. Dafür nahm der Regierungschef auch hin, dass das Parlament vorab nichts erfuhr - und auch Stächele erst kurz vor knapp. Dabei ist der Finanzminister die zentrale Figur, wenn die Regierung notfallmäßig das Haushaltsrecht des Landtags - das sogenannte Königsrecht - umgehen will. In Artikel 81 der Landesverfassung heißt es: "Über- und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Finanzministers. Sie darf nur im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses erteilt werden."
Keine Szenarien für die Übernahme entwickelt
Ein weiteres Geschmäckle bekam das Geschäft noch dadurch, dass Mappus seinen engen Freund und Trauzeugen Dirk Notheis, den Deutschland-Chef der Investmentbank Morgan Stanley, mit der Durchführung des Deals beauftragt hat. Von "Vetterleswirtschaft" spricht die SPD. Spitzenkandidat , dass Mappus dem Parlament keinerlei Szenarien über die Gewinnentwicklung des Unternehmens vorlegte. Allein das sei schon sehr ungewöhnlich. "Bei der Kapitalerhöhung für unsere Landesbank gab es beispielsweise sehr konkrete Angaben von renommierten Wirtschaftsprüfern über die Zukunft des Unternehmens in Abhängigkeit verschiedener Szenarien. Es wäre also naheliegend gewesen, für die EnBW ähnliche Vorgaben zu machen." Es sei nicht einmal errechnet worden, wie sich die Gewinne des Unternehmens mit und ohne Laufzeitverlängerung entwickeln würden. "Herr Mappus ist ohne Konzept und ohne Strategie in das Geschäft gegangen. Deshalb fällt es ihm jetzt folgerichtig auf die Füße. Er sitzt sprichwörtlich in der Tinte."
Mappus ist jetzt tatsächlich gefangen in seiner eigenen Atompolitik, denn sein ganzes Vorhaben fußte auf dem Versprechen der Merkel-Regierung, dass die EnBW die Laufzeitverlängerung bekommt. Er hat sich damit in eine einseitige Abhängigkeit begeben, was die Strategie der EnBW betrifft. Mappus Ziel war es nicht nur, den Atomkonzern wieder in Landesbesitz zu überführen und mit Atomstrom Geld zu machen, er wollte die Unternehmensanteile relativ kurzfristig an die Börse bringen. "Leider hat er dabei übersehen, dass man mit den Atomkraftwerken der EnBW auf die Zukunft gerechnet keinen Gewinn mehr erzielen kann", so Schmid. "Der Laden, so wie er ist, ist zu einem Sanierungsfall geworden."
Ganz so möchte es Mappus' Fraktionschef Peter Hauk nicht stehen lassen. Er rechnet nicht mit einem dauerhaften kräftigen Wertverlust für EnBW im Falle eines schnellen Atomausstieges. Hauk zweifelte wenige Tage vor der Wahl die Dauerhaftigkeit einer Prognose an, in der von einem Wertverlust von 30 Prozent für den Konzern die Rede war, falls auf die Laufzeitverlängerung verzichtet werde. "Also die Frage einer Augenblicksanalyse ist, glaube ich, nicht geeignet, um für die Zukunft die Frage der Werthaltigkeit eines Unternehmens zu sehen", sagte er. Überzeugungsarbeit sieht anders.
Auch die Kanzlerin scheint erkannt zu haben, dass sich Mappus mit seiner Nacht- und Nebelaktion auf dünnes Eis begeben hat. "Ich bin überzeugt, dass die christlich-liberale Regierung ihren energiepolitischen Weg gut begründen kann", sagte Merkel zu dem EnBW-Deal und fügte hinzu: "Ein kluger Ministerpräsident reagiert darauf".
Quelle: ntv.de