Politologe über die Merz-CDU"Ratlosigkeit. Strategielosigkeit. Nervosität"
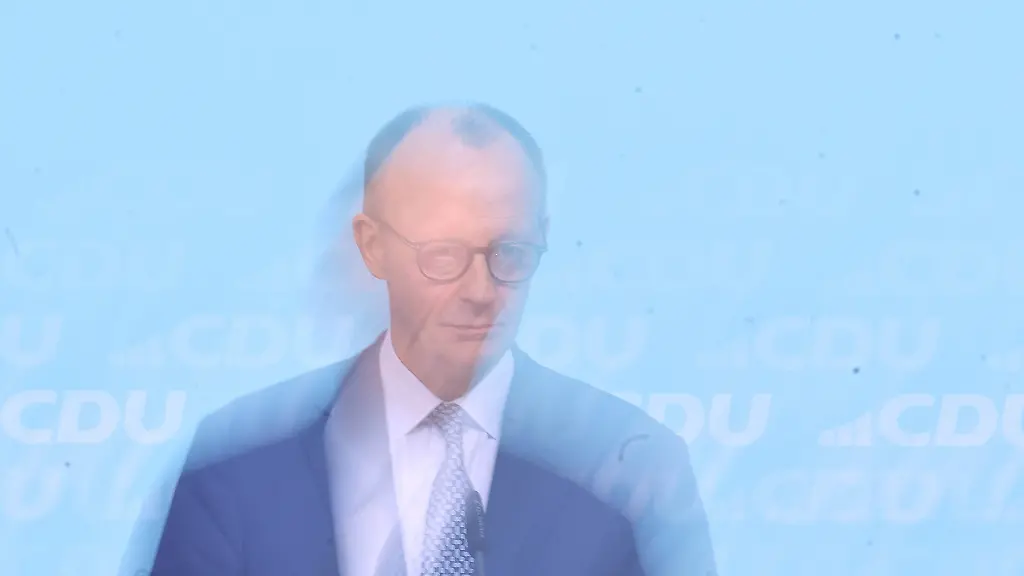
Der Politologe Wolfgang Schroeder attestiert der CDU einen Mangel an strategischer Planung. Was Bundeskanzler Merz über den Umgang mit der AfD sage, sei klug und richtig. Aber dann "reißt er mit seiner unbeholfenen Kommunikation alle Unterschiede zur AfD eher ein, die er eigentlich doch deutlicher machen will", so Schroeder.
Der Politologe Wolfgang Schroeder attestiert der CDU einen Mangel an strategischer Planung. Was Bundeskanzler Merz über den Umgang mit der AfD sage, sei klug und richtig. Aber dann "reißt er mit seiner unbeholfenen Kommunikation alle Unterschiede zur AfD eher ein, die er eigentlich doch deutlicher machen will", so Schroeder. "Der Konflikt mit der AfD wird nicht im Kampf gegen die AfD gewonnen, sondern im Kampf gegen die eigenen Fehler und für eigene positive und nachvollziehbare Ideen zur Gestaltung der Lebenswelt."
ntv.de: Das CDU-Präsidium hat sich am vergangenen Wochenende zu einer Strategietagung getroffen, bei der es zumindest nach außen wirkte, als sei der Umgang mit der AfD das zentrale Thema. Welches Signal geht von diesem Treffen aus?
Wolfgang Schroeder: Einerseits Ratlosigkeit. Strategielosigkeit. Nervosität. Die CDU hat eine Erwartungshaltung geweckt, die überhaupt nicht einzulösen ist. Als die Parteioberen das gemerkt haben, haben sie ein bisschen gegengerudert und gesagt: Naja, eigentlich ging es bei dem Treffen doch vor allem um die Frage, wie wir unsere Wirtschaft wieder in Gang bringen. Bei der Pressekonferenz am Montag stand die AfD dann trotzdem im Zentrum.
Und andererseits?
Merz hat mit seinen Worten zunächst einmal für Klarheit gesorgt und die Wortmeldungen marginalisiert, die es vor dem Treffen gegeben hatte.
Ehemalige Unionspolitiker wie Peter Tauber und Karl-Theodor zu Guttenberg hatten vor der Strategietagung einen anderen Umgang mit der AfD gefordert.
Aber wie tragfähig und nachhaltig diese klare Positionierung von Merz ist, wissen wir nicht. Tatsächlich steht nicht nur die Union in der Kontroverse mit der AfD vor einem grundsätzlichen Dilemma. Auf der einen Seite führt die Anerkennung der AfD als potenzieller Koalitionspartner zu deren Normalisierung, zu ihrer Aufwertung. Auf der anderen Seite führt die scharfe Abgrenzung dazu, dass sich die AfD als Opfer darstellt. Dieses Dilemma ist nicht aufzulösen. Diejenigen, die jetzt in der Union nach Rechtsaußen blinken, scheinen eine Chance zu sehen, die AfD kleiner zu machen und die CDU in ihrer inhaltlichen Substanz aufzuwerten. Dahinter steht allerdings ein großes Missverständnis im Hinblick auf die AfD und die Brandmauer.
Welches Missverständnis?
Bei der viel beschworenen Brandmauer ist das Maß der Dinge nicht, ob man damit die AfD kleinhält oder -macht. Die Brandmauer ist vor allem ein Modus der Selbstbehauptung im Kontext der wehrhaften Demokratie. Und zwar in dem Sinne, dass die demokratischen Parteien sagen: Wir können nicht mit Kräften kooperieren, die uns zerstören wollen, die die Grundlagen und Potenziale dieser Demokratie für eine verantwortliche und freie Gesellschaft nicht anerkennt. Um die AfD kleinzuhalten, sind andere Verhaltensweisen und Instrumente notwendig, die zwar mit der Brandmauer in einem Zusammenhang stehen, ohne die aber die Wähler der AfD nicht zurückholbar sind.
Was könnten Taubers und Guttenbergs Motive gewesen sein?
Positiv gesprochen die Vorstellung, dass, wenn man die AfD als normale Partei behandelt, man deren Opfer- und Mobilisierungsstrategie unterläuft und auf diese Weise sukzessive deren Relevanz reduziert. Negativ gesprochen könnte dahinter aber auch der Versuch stehen, die Union und das politische Koordinatensystem der Republik zu verändern, weiter nach rechts zu verschieben. Die Union steht angesichts der Rechtsentwicklung in Deutschland vor einem Problem, das sie wie ein Schatten begleiten wird: Eine große Mehrheit ihrer Mitglieder und Anhänger will keine Kooperation mit der AfD. Trotzdem kann sie nicht ignorieren, dass es eine eher kleine, aber lautstarke Gruppe kooperationsbereiter Akteure gibt. Mir scheint offensichtlich, dass die, die diese Kooperationsbereitschaft stimulieren, damit dazu beitragen können, die Ausrichtung der Union grundsätzlich zu verändern, vielleicht sogar deren Spaltung zu betreiben.
Die AfD ist nicht die erste erfolgreiche Rechtsaußenpartei in Europa, es gibt Erfahrungen über den Umgang mit solchen Parteien. Was könnte die CDU daraus lernen?
Wir haben mittlerweile eine ganze Reihe empirischer Untersuchungen und Befunde. Dabei zeigt sich ein ums andere Mal, dass konservative Parteien die Verlierer sind, wenn sie die Themen der Rechtsaußenparteien kopieren oder gar deren Koalitionsfähigkeit fördern. Dann wollen die Leute das Original, das dynamischer und mobilisierungsfähiger ist. In einem solchen Wettbewerb ist für die CDU nichts zu gewinnen. Das weiß die Union eigentlich auch. Erst vor Kurzem ist eine Studie der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung erschienen, die den Umgang anderer Parteien aus der Familie der Europäischen Volkspartei mit rechtspopulistischen und rechtsextremen Kräften untersucht.
Da heißt es, entscheidend seien klare rote Linien gegenüber antidemokratischen Kräften und die glaubwürdige Besetzung zentraler Themen.
Und trotzdem gibt es bei einem kleinen, aber lautstarken Teil der CDU die Versuchung, die AfD entweder zu kopieren oder gar sich ihrer zu bemächtigen, um so neue machtpolitische Möglichkeiten zu haben. Dabei steht die Analyse Pate, die Wähler hätten mehrheitlich rechts der Mitte gewählt und würden links der Mitte regiert. Um diesem paradoxen Spiel ein Ende zu bereiten, solle sich die Union aus der babylonischen Gefangenschaft durch SPD und Grüne befreien. Ich halte dies für eine vollkommen unangemessene Analyse der Lage, in deren strategischer Konsequenz das erste Opfer die CDU wäre.
Babylonische Gefangenschaft bedeutet aber auch, dass die CDU in Wahlkämpfen mit konservativen Positionen antritt, diese dann aber nicht einlösen kann, weil sie keinen konservativen Koalitionspartner hat.
Die Gegenüberstellung von links und rechts trägt in der Positionsbestimmung zur AfD nicht. Da geht es nicht um den klassischen Konflikt linker und rechter Positionen, sondern um den Erhalt oder die Zerstörung unserer Demokratie. Im Hinblick auf diese Demarkationslinie steht die Union gegenwärtig in ihrer überwältigenden Mehrheit noch auf Seiten der Demokratie, so wie sie unserer Verfassung entspricht. Im Gegensatz dazu tun die kooperationsbereiten Teile der Union so, als sei eine Schnittmenge mit der AfD entwickelbar, wenn die nur etwas von ihren rohen und halbstarken radikalen Positionen abrückt. Aber das ist nicht möglich. Die AfD-DNA bedient eine Rhetorik der Zerstörung, des Niedergangs, die Idee einer anderen Republik. Mit der Geschichte, der Programmatik, den Errungenschaften, aber auch mit den Positionen der Mehrheit ihrer Mitglieder, Wähler und Mandatsträger ist das für die CDU gegenwärtig nicht zu vereinbaren.
Das ist so auch von CDU-Politikern zu hören.
Der Union als Ganzes aber steht dieser Lernprozess noch bevor. Sie hat noch immer nicht hinreichend verstanden, dass dieser doppelte Wettbewerb - der Wettbewerb innerhalb der demokratischen Mitte und der Wettbewerb mit extremen Kräften - ihre ganze Konzentration auf das Projekt der Demokratie verlangt. Deshalb hat Merz in der Pressekonferenz am Montag ja auch selbst wortstark insistiert, dass es zwischen der CDU und der AfD keinerlei Schnittmengen gibt und es somit auch keine Verbindungslinien geben darf. Da kann man durchaus sagen: Diejenigen, die argumentieren, die Brandmauer habe nichts gebracht, man brauche jetzt mal neue Methoden, folgen einer Analyse, deren empirische Substanz nicht belastbar ist. Mit Blick auf die empirischen Befunde aus den internationalen Vergleichen weiß man: Diese Strategie ist dazu angetan, die AfD aufzuwerten und die Grenze zwischen der demokratischen Mitte und dem extremen Sektor zu verwischen.
Sie meinen, bislang hatte die CDU keine stringente Strategie im Umgang mit der AfD?
Sie hat verschiedene Ansätze probiert. Aber eine wirklich konsistente Strategie ist nicht erkennbar. Kein Parteienverbot, Brandmauer nur für die gesetzgebenden Ebenen, und dann immer wieder auch viel situative Flexibilität, wofür nicht zuletzt der Antrag zum Migrationsplan mit AfD-Unterstützung im Bundestag nach dem Aschaffenburger Attentat steht. Aber manchmal auch das Gegenteil von allem, je nachdem, mit wem man in der Partei zu welchem Zeitpunkt spricht.
Aber aufs Ganze ist trotzdem klar, dass die CDU bislang eine Annäherung an die AfD nicht für möglich hält. Merz hat übrigens in der Pressekonferenz am Montag kluge Sachen gesagt. Zum Beispiel, dass die Bundesregierung besser regieren muss, und dass die Unterschiede der CDU zur AfD deutlicher werden müssen. In der Praxis sorgt er aber selbst dafür, diese Unterschiede zu relativieren, indem er die Themen der AfD hochspielt. Zum Beispiel mit seinem Satz zum "Stadtbild". Merz sollte sich lieber auf seine Themen, in denen er authentisch ist, konzentrieren, also auf die Wirtschafts-, Sozial- und Außenpolitik. In den soziokulturellen Themen sollte er nicht polarisieren, sondern die Themen stärker evidenzbasiert aufnehmen und zusammenführen, statt selbst durch ambivalente Äußerungen zu polarisieren. Er ist kein Oppositionspolitiker, sondern der Kanzler eines nervösen Landes, das nicht mehr, sondern weniger Temperatur braucht.
In Potsdam hatte Merz vor einer Woche gesagt, seine Bundesregierung habe bei der Migration die Zahlen im Jahresvergleich "um 60 Prozent nach unten gebracht". Dann folgte der Satz: "Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem. Und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen."
Zunächst einmal zeigt der Satz, dass Merz in der Kommunikation über solche Fragen, also über soziokulturelle Fragen, ungeübt und hilflos wirkt. Zugleich erweckt er Erwartungen, die er nicht erfüllen kann, und befeuert so noch die Unzufriedenheit der Leute. Vor allem aber reißt er mit seiner unbeholfenen Kommunikation alle Unterschiede zur AfD eher ein, die er eigentlich doch deutlicher machen will.
Würden Sie sagen, dass die "Stadtbild"-Aussage einen rassistischen Unterton hatte? Wollte Merz absichtlich eine bestimmte Wählergruppe ansprechen?
Das würde ich nicht unterstellen. Ich finde auch, dass man über das Stadtbild diskutieren kann und muss, wenn da bestimmte Fehlentwicklungen erkennbar sind und man als Kanzler selbst ein differenziertes Bild und pointierte Lösungsstrategien hat. Aber so, wie Merz das gemacht hat, hat er nur Wasser auf die Mühlen der AfD gelenkt. Merz hinterlässt den Eindruck, dass seine Forderung nach Abgrenzung von der AfD gar nicht so ernst gemeint ist. Es ist das Gegenteil von Standhaftigkeit, Wehrhaftigkeit und Berechenbarkeit; eher flexibel und nutzenorientiert.
Was würden Sie Merz oder der CDU raten? Wie können christdemokratische und konservative Parteien rechtspopulistische Wähler zurückgewinnen?
Merz' Botschaft ist richtig: Der Regierungsstil muss besser werden, und die Regierung muss daran arbeiten, die Lebensverhältnisse der Menschen zu verbessern. Zugleich muss sie die Bevölkerung an den Schwierigkeiten des Umbaus dieser Gesellschaft teilhaben lassen und dies durch ein berechenbares, nachvollziehbares Erwartungsmanagement begleiten. Das ist der erste, der entscheidende Punkt. Der Konflikt mit der AfD wird nicht im Kampf gegen die AfD gewonnen, sondern im Kampf gegen die eigenen Fehler und für eigene positive und nachvollziehbare Ideen zur Gestaltung der Lebenswelt. Das ist das Feld, auf dem sich Mitte-Parteien bewegen und behaupten müssen.
Und zweitens?
Das zweite Feld, das Merz richtigerweise benannt hat, ist die Herausarbeitung der Unterschiede. Die CDU sollte deutlich machen: Wir haben bei einzelnen Themen durchaus große und kleinere Konflikte mit der SPD, mit den Grünen, auch mit der Linkspartei. Aber das sind Konflikte im Rahmen des demokratischen Korridors. Denn diese Parteien sind bereit, sich auf den Mechanismus von Argument und Gegenargument, von Konflikt und Kompromiss so einzulassen, dass am Ende gilt, was ausgehandelt wurde. Wenn man dies durchdekliniert, dann wird man sich auch klar darüber, in welchen Feldern Zuspitzungen strategisch sinnvoll sind und in welchen Feldern man besser komplexer argumentieren sollte. Grundsätzlich sollte eine Partei der Mitte den Konflikt lieber bei sozio-ökonomischen Themen suchen.
Also in der Sozial- und Wirtschaftspolitik. Warum?
In diesem Gebiet sind Kompromisse möglich und für das Publikum nachvollziehbar. Bei soziokulturellen Fragen ist das eher schwieriger und manchmal gar nicht möglich: Das sind Konflikte, die sich meist nicht auflösen lassen. Übrigens hatte auch der Konflikt um die Nachfolge beim Bundesverfassungsgericht Züge dieses Konfliktes. Solche Konflikte tragen zur Polarisierung der Gesellschaft bei und bedienen damit das Geschäft der AfD, die ein Interesse an einer polarisierten Niedergangs- und Untergangsgesellschaft hat. Aber wir werden mit diesen Konflikten auch zukünftig leben; ebenso wie wir mit einer starken AfD besser umgehen lernen müssen, ohne gleich das Ende der Demokratie zu postulieren.
Mit Wolfgang Schroeder sprach Hubertus Volmer