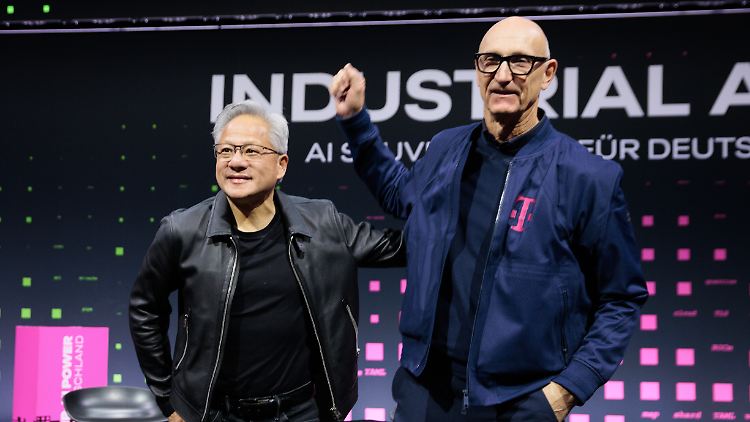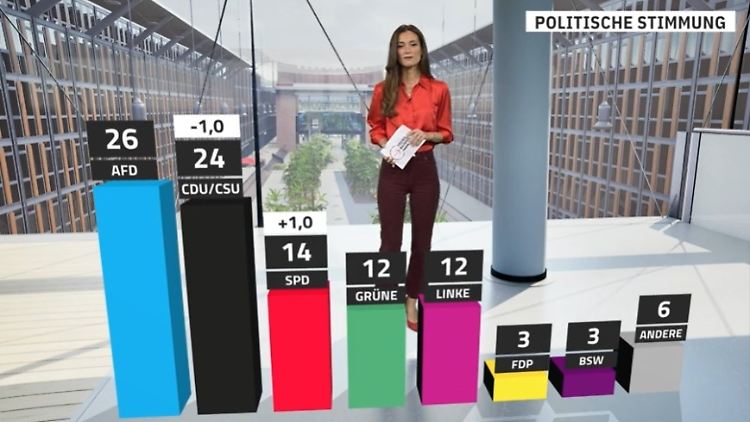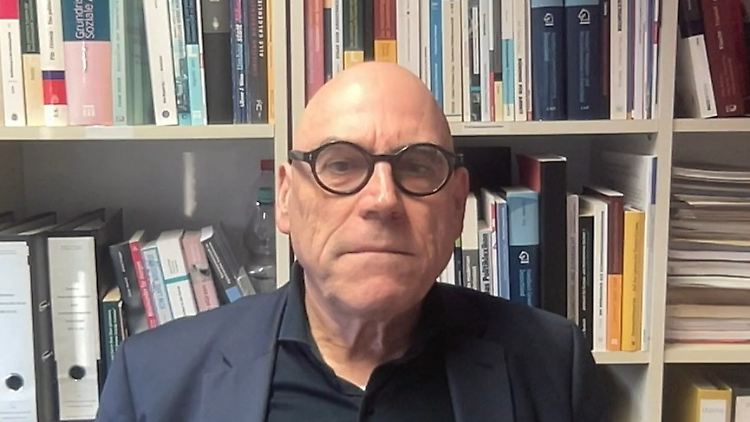Kein Zuschuss für die Bundeswehr Merkel handelt unverschämt richtig
10.09.2014, 15:51 Uhr
Angela Merkel: "In diesem Zusammenhang brauchen wir jetzt keine neuen finanziellen Mittel."
(Foto: picture alliance / dpa)
Die neue Bedrohung durch Russland schreckt die Nato auf. Rufe nach höheren Verteidigungsausgaben der Mitgliedstaaten ertönen immer wieder. Kanzlerin Merkel ignoriert sie - zu Recht.
Es klingt unverschämt: Beim Nato-Treffen in Wales unterzeichnet Kanzlerin Angela Merkel Passus 14 des Gipfelbeschlusses. Die Mitglieder der Militärallianz verpflichten sich darin, ihre Verteidigungsbudgets in den nächsten zehn Jahren auf mindestens zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts zu heben und davon 20 Prozent in Rüstungsprojekte zu investieren. Kaum eine Woche später und zurück in Berlin tut Angela Merkel so, als gebe es jenen Passus nicht. Der Bundestag debattiert den Haushalt für das nächste Jahr, und die Kanzlerin setzt sich dafür ein, den deutschen Verteidigungsetat bei 1,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu belassen.
Ganz so unerhört, wie es zunächst klingt, ist Merkels Vorgehen allerdings nicht. Natürlich ist es unanständig, Versprechen zu brechen. Klammert man Fragen des Anstands und der Diplomatie aus, gibt es aber viele gute Gründe dafür, nicht mehr Geld für die Bundeswehr auszugeben.
Die Zwei-Prozent-Marke ist ein fragwürdiges Instrument, um die Lasten zwischen den Mitgliedstaaten gerecht zu verteilen. In der Tat klaffen zwischen den Beiträgen der einzelnen Länder gewaltige Lücken. Die Vereinigten Staaten etwa gaben im vergangenen Jahr 4,4 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung aus. Die Türkei 1,8 Prozent. Auf der andern Seite gibt es Staaten wie Litauen, die kaum auf 1 Prozent kommen. Sich auf 2 Prozent zu verständigen, erscheint da nur fair. Allerdings geben die "Vorzeige-Nato-Staaten" nicht völlig selbstlos mehr Geld aus.
Von wegen Bündnis-Interessen
Oft verfolgen sie keine Bündnisinteressen, sondern nationale Ziele, wenn sie zusätzliche Milliarden springen lassen. Der Verteidigungsetat der USA ist bekanntlich auch deshalb so gewaltig, weil der frühere Präsident George W. Bush damit seinen Krieg gegen den Terror finanzierte - in einem Ausmaß, das bei weitem nicht jedem Mitgliedstaat Recht war.
In das Militär der Türkei floss in der Vergangenheit auch so viel Geld, weil Ankara massiv gegen die kurdische Arbeiterpartei PKK vorging. Ein großer Verteidigungsetat heißt nicht zwangsläufig, dass ein Nato-Mitglied mehr für das Bündnis tut.
Hinzu kommt: Der Nato mag es an vielem fehlen. Selbst angesichts der neuen Bedrohung aus Moskau mangelt es ihr an einem sicherlich nicht: an Geld. All seinen Bemühungen zum Trotz schafft es der Kreml nur, ein Zehntel der Summe aufzubringen, die die 28 Mitgliedstaaten alljährlich zusammentragen. Mit dem Ende des Afghanistan-Einsatzes dürften zudem künftig wieder Milliarden für neue Unternehmungen bereitliegen.
Dass die Nato sich nicht ausreichend gewappnet fühlt, für die Krisen dieser Welt, hat andere Gründe. Sie setzt das Geld, das ihr zur Verfügung steht, nicht sinnvoll ein. Besonders deutlich wird das bei den Mitgliedern aus der EU. Oft war in Brüssel schon von "Pooling and Sharing" die Rede, dem Versuch militärische Kompetenzen der verschiedenen Mitgliedstaaten, gemeinsam zu nutzen. Doch ernsthaft verfolgt haben die Regierungen der Länder dieses Ziel nicht - oft aus absurden nationalistischen Motiven. Europa wächst immer stärker zusammen. Trotzdem halten die Mitgliedstaaten weiterhin eigene Armeen mit allen erdenklichen Fertigkeiten bereit. Doch die Mitgliedstaaten, die so agieren, erhalten nur eine Scheinautarkie aufrecht. Es ist vollkommen klar, dass sie auf sich allein gestellt in dieser Welt wenig gegen einen Aggressor ausrichten könnten. Mindestens so irrsinnig ist, dass sie weiterhin parallel Rüstungsgroßprojekte betreiben. Sie geben Milliarden für Forschung und Entwicklung aus. Das mag der heimischen Waffenwirtschaft nützen. Die Kosten für die Verteidigung allerdings treibt es unnötig in die Höhe.
Neue Wege des Lastenausgleichs
Angesichts derartiger Verschwendung gibt es offensichtlich mehr als genug finanzielle Spielräume, um zusätzliche Aufgaben wie die neue besonders schnelle Eingreiftruppe der Nato zu finanzieren. Kanzlerin Merkel sagte zu Recht kurz vor der Haushaltsdebatte: "In diesem Zusammenhang brauchen wir jetzt keine neuen finanziellen Mittel."
Anständiger wäre es selbstredend gewesen, wenn Merkel schon auf dem Gipfel in Wales klar gemacht hätte: Die Nato muss sich von dem Zwei-Prozent-Ziel verabschieden und neue Wege finden, die Lasten zwischen den Mitgliedstaaten gerecht zu verteilen.
Wie könnte so eine neue Lastenverteilung aussehen? Abgesehen von der Rüstungsindustrie ist niemandem geholfen, wenn Nato Staaten Geld ausgeben, nur um eine Quote zu erfüllen. Das Bündnis sollte sich mehr denn je Gedanken darüber machen, welche Fähigkeiten es wirklich und in welchem Umfang braucht. Dann sollte es abwägen, wer diese Fähigkeiten am schnellsten, billigsten und besten bereitstellen kann. Kommt es dann immer noch zu Ungerechtigkeiten zwischen den Nato-Partnern, spricht nichts dagegen, diese durch Ausgleichszahlungen zu beheben. Angst vor ungeahnten Mehrbelastungen muss dabei niemand haben. Denn am Ende dürfte der Gesamtetat der Nato bei einer klugen Aufgabenverteilung deutlich kleiner ausfallen als heute.
Quelle: ntv.de