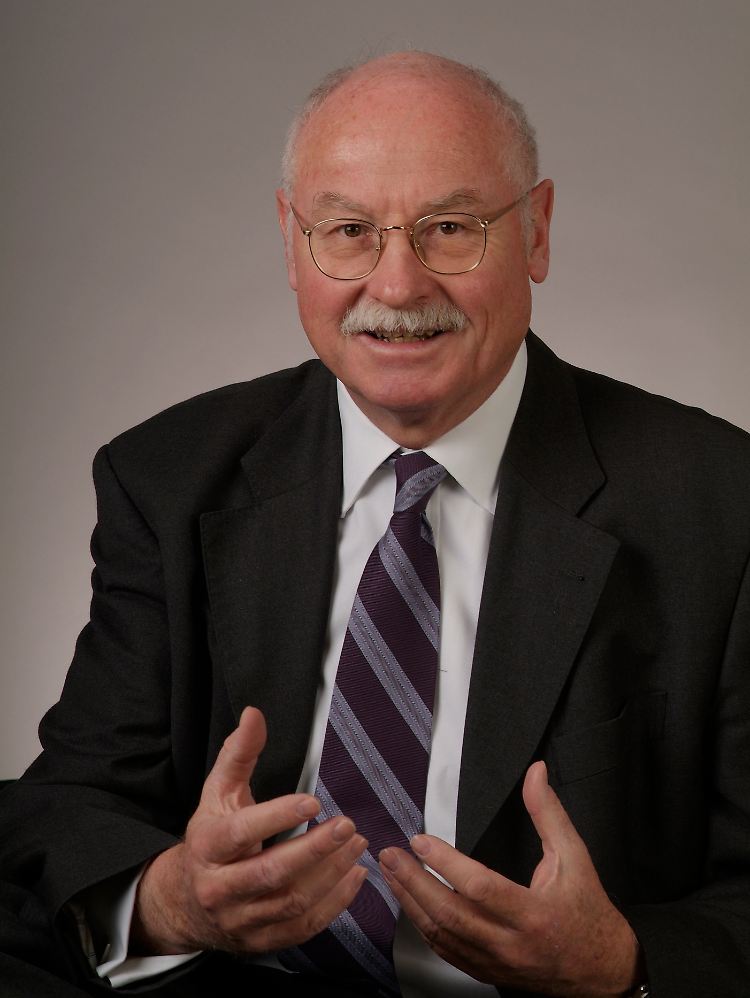Volkswirte nehmen Zinsen locker "US-Bonds sind erstklassige Anlage"
28.04.2011, 14:55 Uhr
(Foto: REUTERS)
Die US-Notenbank Fed hält ihren Leitzins anders als die EZB bei nahe Null. Selbst die Ankäufe von Staatsanleihen sollen trotz des Wirtschaftsaufschwungs fortgesetzt werden. Offiziell läuft das milliardenschwere Programm zwar Ende Juni aus. Die Fed will aber die Erträge aus fällig gewordenen hypothekenbesicherten Papiere vorerst noch reinvestieren. Gibt es angesichts der aggressiven Geldpolitik in den USA für deren Staatsanleihen überhaupt noch Käufer? Und müsste die EZB nicht viel aggressiver die Zinsen erhöhen? Führende Volkswirte äußern sich gegenüber n-tv.de entspannt. Einen Finanzierungsengpass in den USA sehen sie nicht. Ihrer Ansicht nach nimmt auch die EZB den richtigen Kurs. Wird trotzdem ein US-Bundesstaat oder ein Euroland Pleite gehen?
n-tv.de: Der Aufkauf von Bonds durch die Fed läuft Ende Juni aus. Danach will die US-Notenbank nur noch die Erträge auslaufender Papiere reinvestieren. Glauben Sie, dass es ein weiteres Aufkaufprogramm, also ein Quantitative Easing 3, geben wird?
Norbert Walter: Wegen relativ guter Konjunktur, Rohstoffpreissteigerungen und drohender Effekte der Herabstufung durch Rating-Agenturen: Nein, kein QE 3.
Martin Hüfner: Nein, das Programm wird so nicht weitergeführt. Es ist nicht mehr nötig und es regt sich zunehmend auch in der Fed Widerstand dagegen. Aber es wird Übergangslösungen geben (zum Beispiel die Wiederanlage der Zinserträge im Portfolio der Fed).
Holger Schmieding: Nein, glaube ich nicht. Allerdings wird die Fed wahrscheinlich auslaufende Anleihen durch neue ersetzen und so vorerst ihren Bestand unverändert halten.
Wer soll künftig anstelle der Fed die ganzen Staatsanleihen kaufen?
Martin Hüfner: Das muss dann der Markt tun. Ich habe keine Angst, dass es an Nachfrage fehlen wird. Es ist nach wie vor viel Geld vorhanden, das Anlage sucht. Und dann sind da ja auch noch die Chinesen. Die Amerikaner haben kein Finanzierungsproblem (wie einige europäische Staaten).
Holger Schmieding: Die üblichen Käufer aus dem In- und Ausland. US-Staatsanleihen bleiben eine erstklassige Anlage mit einem liquiden Markt, den es so für kein anderes Wertpapier gibt. Allerdings wird die Rendite wohl etwas steigen müssen, um Käufer anzulocken.
Vor allem bei den Amerikanern selbst schlummern den Experten zufolge Geldreserven, die Anlagemöglichkeiten suchen.
Holger Schmieding: Die Sparquote der US-Haushalte ist in den Jahren 2008-2010 erheblich gestiegen, von 2 Prozent auf knapp 6 Prozent. Mit einem Teil dieser zusätzlichen Ersparnis könnten US-Bürger Staatsanleihen kaufen.
Etwas skeptischer beurteilt Norbert Walter die Nachfrageseite.
Norbert Walter: Wie sich das gehört. Es sollen die Sparer der USA oder die des Rests der Welt tun! Wohl aber nicht bei einem Dollar, der noch Abwertung vor sich hat, und Kapitalmarktzinsen, die zu niedrig sind, um die Risiken auszugleichen.
In Europa hat der Zinserhöhungszyklus bereits begonnen. Anfang des Monats erhöhten die Währungshüter erstmals seit Juli 2008 den Leitzins von 1,0 auf 1,25. Ökonomen rechnen wegen des anhaltenden Preisdrucks mit weiteren Erhöhungen bis auf 1,75 Prozent bis Ende 2011.
Angesichts einer Inflation von 2,75 Prozent in Euroland: Müsste die EZB da nicht deutlich aggressiver vorgehen?
Martin Hüfner: Aus Sicht der Deutschen wäre ein sehr viel beherzteres Vorgehen angebracht. Aber die EZB macht eine Geldpolitik für ganz Europa und da sieht die Konjunktur noch nicht so gut aus.
Holger Schmieding: Nein, höhere Ölpreise allein sind kein Grund für höhere Zinsen. Da das Bankwesen langsam gesundet und die Euro-Wirtschaft wieder wächst, sollte die EZB schrittweise auf eine weniger expansive Politik umschalten. Genau dies tut sie.
Norbert Walter: Die EZB muss nur aggressiv gegensteuern, wenn die Inflationserwartung auf mittlere Frist die 2 Prozent nachhaltig übersteigt. Freilich, zwei weitere 25 Basispunkte Zinssteigerung beim Repo in 2011 sind nicht aggressiv, sondern wohl sachgerecht (unterstellt, der Dollar ist nicht schwächer als 1,55 Euro!).
Unterstellt, wir hätten noch die D-Mark und die Bundesbank würde die Geldpolitik bestimmen. Was meinen Sie, wo würden die Leitzinsen stehen in Anbetracht einer Inflationsrate von fast 3 Prozent, eines für deutsche Verhältnisse rekordhohen Wirtschaftswachstums und sinkender Arbeitslosenzahlen?
Norbert Walter: Ich weiß es nicht, weil ich nicht wüsste, um wie viel die D-Mark aufwerten würde und wie realistisch das Szenario "hohe Inflation und fortgesetzt hohes Wachstum" im Fall der Beibehaltung der D-Mark wäre.
Martin Hüfner: Die Bundesbank hätte mit dem Straffen sehr viel früher angefangen und sie läge jetzt sicher schon bei 2 bis 2,5 Prozent. Aber noch einmal: das darf man der EZB nicht als Schwäche auslegen. Sie ist für einen anderen Raum tätig.
Ein besonderes "Risiko" für Deutschland geht nach Ansicht der Ökonomen von der europäischen Zinspolitik nicht aus.
Holger Schmieding: Die Bundesbank alleine hätte vermutlich bereits im Herbst 2010 die Zinsen erhöht. Allerdings ist die deutsche Inflation (im April 2,4 Prozent) weiterhin unter der Rate in der übrigen Eurozone (2,8 Prozent). Deshalb kann keine Rede davon sein, dass die EZB eine Geldpolitik betreibt, die Deutschland besonderen Inflationsgefahren aussetzt. Seitdem sie die Geldpolitik übernommen hat, hat die EZB die deutsche Inflation im Schnitt bei 1,5 Prozent gehalten. In den gut 40 Jahren vorab hat die Bundesbank im Schnitt die Preise jeweils um 2,9 Prozent steigen lassen. Insgesamt hat die EZB bisher gerade auch für Deutschland ihre Sache hervorragend gemacht.
Im Gegensatz zur Fed ist die EZB ausschließlich der Geldwertstabilität verpflichtet. Ist die bislang immer noch lockere Geldpolitik nicht dennoch ein Zugeständnis an die schwache Konjunktur in den PIGS-Staaten?
Holger Schmieding: Nein. Die EZB hat ihre Zinsen nie so weit gesenkt, wie es die Fed und die Bank of England getan haben. Sie hat ihre Zinsen früher wieder erhöht als andere große Zentralbanken. Sie orientiert sich offenbar weit mehr an Deutschland als an den Ländern der Peripherie, für die die mit P beginnende Abkürzung kein angemessener Titel ist.
Martin Hüfner: Das ist kein Zugeständnis an die Peripheriestaaten, es ist eine Politik, die an die Daten des Euroraums angepasst ist. Im letzten Jahr lag die Wachstumsrate in Deutschland bei 3,6 Prozent, in Euroland war sie mit 1,7 Prozent nur halb so groß. Wichtig ist: die Peripheriestaaten haben im EZB-Rat der Zinserhöhung ebenfalls zugestimmt, obwohl sie für sie eine große Belastung ist.
Norbert Walter: Bislang ist die EZB ihrer Priorität für Preisstabilität (knapp unter 2 Prozent) noch nicht untreu geworden. Die Expertenumfragen und die Kapitalmärkte signalisieren (noch) keine Erhöhung der Inflationserwartungen oberhalb dieses Niveaus.
Ist der rekordhohe Goldpreis ein Misstrauensvotum gegen die Papierwährungen Euro und Dollar bzw. gegen die lockere Geldpolitik der Fed und der EZB?
Holger Schmieding: Der hohe Goldpreis drückt auch die Sorge vieler Anleger vor großen Risiken aus, zu denen auch die Risiken einer neuen Rezession, einer schlimmeren Schuldenkrise und einer wesentlich höheren Inflationsrate gehören.
Martin Hüfner: Der hohe Goldpreis ist sicher ein Krisensymptom. Er richtet sich aber nicht gegen irgendeine Zentralbank. Die Anleger haben eher Angst, dass die hohe Staatsverschuldung außer Kontrolle geraten könnte. Es ist ein Misstrauensvotum gegen die Staatsfinanzen.
Norbert Walter: Ja, aber Märkte - gerade solche emotional geprägten – haben hin und wieder geirrt.
Was ist die größere Belastung für die Währungen Euro und Dollar: Die Staatsschuldenkrise in Europa ("PIGS") und USA (Staat, Bundesstaaten und Kommunen) oder die anziehende Inflation?
Norbert Walter: Im Falle des Dollar gehen die beiden Phänomene wohl eher Hand in Hand, deshalb ist die Zurechnung quasi unmöglich. Wenn dem Euro etwas schadet, dann ist es eindeutig die Staatschuldenproblematik und nicht die Inflation. Angesichts eines Wechselkurses von über 1,46 US-Dollar ist diese These aber eher unpassend. Der Dollar ist halt noch schwächer als der Euro.
Martin Hüfner: Eindeutig die Staatsschuldenkrise. Anleger haben Angst vor einer großen Inflation, einem Zerbrechen der Währungen. Die "kleine Inflation", die sich in den monatlichen Preissteigerungsraten zeigt, spielt noch keine so große Rolle. Der Euro/Dollar Wechselkurs wird sehr stark von der unterschiedlichen Zinspolitik in den USA und in Europa geprägt.
Eine andere Auffassung vertritt Holger Schmiedung. Für ihn machen weder Schulden noch Inflation die Kurse.
Holger Schmieding: Keiner dieser Faktoren bestimmt derzeit den Wechselkurs. Der wird stattdessen vor allem von den US-europäischen Zinsdifferenzen getrieben.
Glauben Sie, dass einer der europäischen Peripheriestaaten oder einer der Bundesstaaten in den USA Pleite gehen wird? Und wenn ja: Wen trifft es zuerst?
Martin Hüfner: Ja, das kann passieren, sowohl in den USA als auch in Europa. Wo das zuerst passiert, weiß ich nicht. Im Augenblick sieht es eher nach Europa aus. Aber das kann sich bei der hohen Staatsverschuldung auch in den USA sehr schnell ändern.
Norbert Walter: Pleite im Sinne einer geordneten Umschuldung: Ja. Früher für den einen oder anderen Europäer, später ist das auch für die USA nicht ausgeschlossen.
Holger Schmieding: Vermutlich wird kein US-Bundesstaat seinen Schuldendienst einstellen. Ob Griechenland umschulden muss, obwohl es seine Haushaltspolitik drastisch geändert hat, hängt vor allem von der Diskussion in Berlin ab. Wenn wir Griechenland die im EU-IWF-Programm vereinbarte Zeit geben, die Früchte seiner Reformen zu ernten, hat es noch eine Chance. Wenn wir die Sache aber jetzt übers Knie brechen wollen, müsste Griechenland auch auf Kosten der deutschen Anleger und Steuerzahler umschulden.
Die Fragen an Martin W. Hüfner, Chefvolkswirt Assenagon Asset Management, Holger Schmieding, Chefvolkswirt Berenberg Bank und Norbert Walter, n-tv-Finanzexperte stellte Diana Dittmer.
Quelle: ntv.de