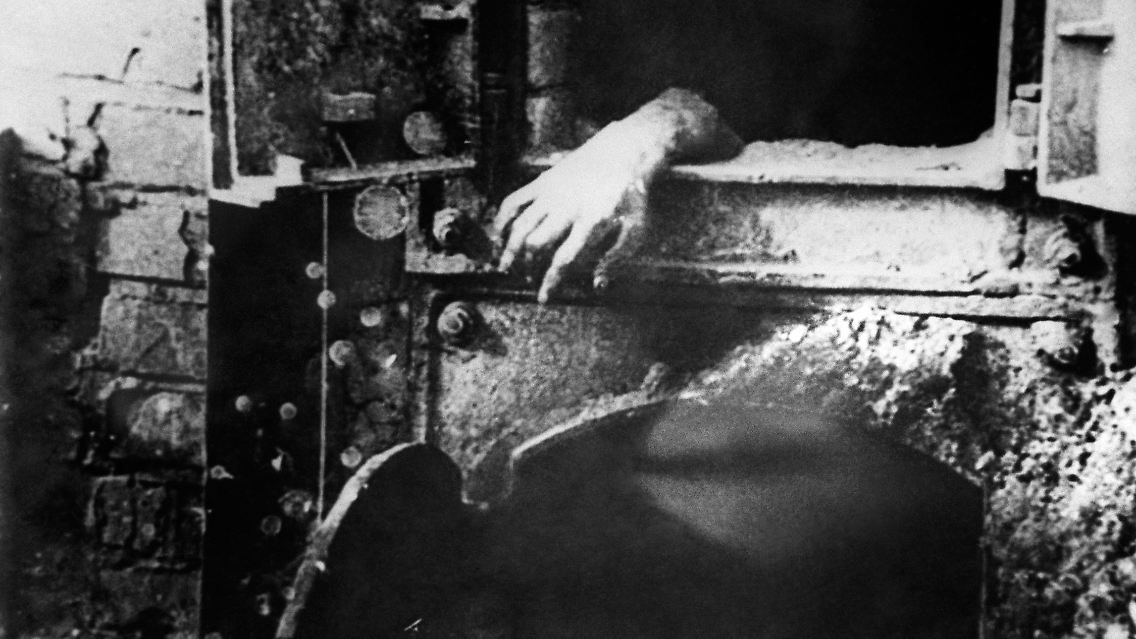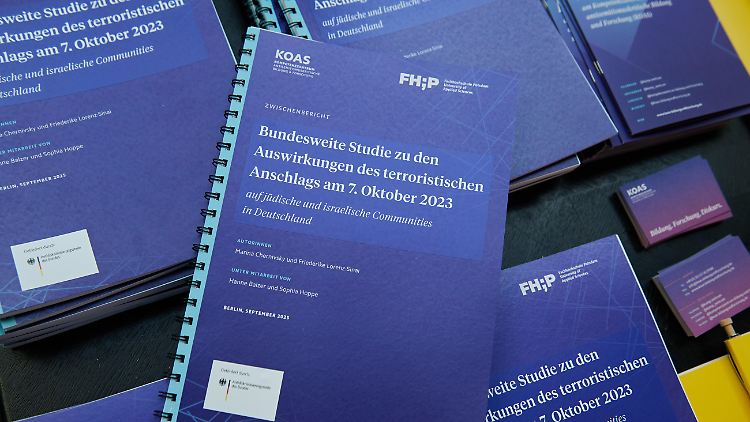"Haben mit den Mädchen poussiert" Die schöne Zeit und der Polen-Feldzug
01.09.2014, 13:48 Uhr
"Volksdeutsche" bejubeln in Polen den Einmarsch der Deutschen.
(Foto: AP)
Im Morgengrauen fallen die ersten Bomben. Wehrmachtssoldaten überrennen Polen und entfesseln so vor 75 Jahren den Zweiten Weltkrieg. Mit dabei ist auch der 18-jährige Werner Pawlitzki , dem es vor allem "um Naheliegendes" geht.
Der Krieg lag schon in der Luft. Als das Arbeitskommando in Bestensee bei Berlin am 26. August 1939 nach Mährisch-Ostrau abkommandiert wurde, wunderte sich der damals 18-jährige Werner Pawlizki nicht. "Überrascht waren wir nicht", sagt er heute, 75 Jahre später. "Wir haben sogar damit gerechnet, als wir dahin geschickt wurden, dass der Krieg kommt und dass wir gebraucht werden."
Wenige Tage später kam er dann, der Krieg, der so erst nicht genannt werden durfte. Am 1. September verkündete Adolf Hitler im Reichstag den Überfall auf Polen: "Seit 5 Uhr 45 wird jetzt zurückgeschossen." Vorwand für den Überfall war ein angeblicher Angriff von Polen auf den Rundfunksender in der Grenzstadt Gleiwitz, den tatsächlich allerdings SS-Leute in polnischen Uniformen verübt hatten.
Noch vor Sonnenaufgang nahm das Marineschiff "Schleswig-Holstein" den polnischen Militärposten auf der Halbinsel Westerplatte bei Danzig unter Beschuss. Deutsche Kampfbomber griffen zudem die zentralpolnische Stadt Wielun an: Mehr als 1200 Menschen starben - sie waren die ersten von rund 55 Millionen, die der Krieg in den kommenden Jahren fordern sollte.
"Ich habe von der Chose nicht so viel mitbekommen", meint Pawlizki, der damals von Mährisch-Ostrau über Krakau nach Tarnow zog, heute. Als Baukompanie seien sie zwar der Wehrmacht unterstellt gewesen, hätten aber keine Gewehre gehabt und auch gar nicht schießen dürfen. "Wir waren eingeteilt als Hilfe für die Wehrmacht", so Pawlitzki. Sie hätten lediglich unterstützende Aufgaben gehabt, wie die Bewachung von Gebäuden oder Gefangenen. Und dann sei der Krieg in Polen ja so schnell vorbeigewesen.
"Feldzug der 18 Tage"
Tatsächlich feierte die NS-Propaganda später den Sieg über Polen als "Feldzug der 18 Tage". Innerhalb weniger Wochen hatte die deutsche Wehrmacht die Kämpfe für sich entschieden. Die Deutschen besaßen nicht nur die bessere Technik, sie verfügten auch über deutlich mehr Panzer und Kampfflieger, die sie bei der Bombardierung Warschaus großflächig einsetzten.
Großbritannien und Frankreich erklärten zwar am 3. September Deutschland den Krieg, leisteten aber ihrem Verbündeten Polen keinen Beistand. Und vom östlichen Nachbarn, der Sowjetunion, war nichts Gutes zu erwarten. Erst im August hatten Deutschland und die Sowjetunion im "Hitler-Stalin-Pakt" die Aufteilung Polens beschlossen. Am 17. September erklärte Josef Stalin, Diktator der Sowjetunion, Polen für nicht mehr existent und gab den Befehl zum Einmarsch - angeblich aus Sorge um das Schicksal der dort lebenden Ukrainer und Weißrussen. Noch in der Nacht floh die polnische Regierung außer Landes, wenig später kapitulierten die letzten Feldtruppen Polens.
Am 18. September schrieb Pawlizki in sein Tagebuch: "Alle Züge waren mit Flüchtlingen und zurückgelassenem Flüchtlingsgut voll besetzt. Es riecht nach Leichen. Schon vorher habe ich diesen Geruch bemerkt. Den ganzen Tag haben wir nichts zu essen. Wir müssen den Hundekuchen essen."
Bis zu 100.000 polnische Soldaten starben bei dem deutschen Überfall, auch Zehntausende Zivilisten - viele von ihnen bei der Bombardierung Warschaus. Rund 400.000 Soldaten und 200.000 "verdächtige Elemente" gerieten in deutsche Gefangenschaft, einige von ihnen bewachte auch die Baukompanie Pawlitzkis.
Der inzwischen 93-Jährige, der nach dem Krieg als Jurist für den Berliner Senat arbeitete, erinnert sich nur noch vage an die Tage des "Blitzkriegs" und die nachfolgende Besatzung: Mit den Polen habe er wenig Kontakt gehabt, sagt er. An Leichen könne er sich nicht erinnern, auch nicht an Gräuel. Einmal habe ihm ein Rekrut - mit Abscheu und Distanz - erzählt, wie kurz nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 Juden in einer Kirche zusammengepfercht wurden und diese dann angezündet worden sei. Andere Juden habe man Gräben ausheben lassen und abgeknallt. "Da habe ich das zum ersten Mal erfahren."
Die Bedeutung vieler Ereignisse nahm Pawlizki wohl kaum wahr. "Wir waren ja zu Beginn des Krieges noch gar nicht mal erwachsen. Und ich war noch etwas jünger, als ich wirklich war. Ich war ja noch ein richtiger Junge." Die Lehrer seien Nazis gewesen, sie auch.
Letztlich sei es "nur ums Naheliegende" gegangen, meint er heute: "Als Soldat denkt man nur ans Fressen und an Mädchen." Wenn er sich nun erinnert, dann viel an die Mädchen in den folgenden Jahren und dass er tanzen ging. Besonders in Warschau, wo er von 1940 bis 1941 als Fernsprecher eingesetzt war, habe er die Tage genossen. Das sei ja das "Paris des Ostens" gewesen. "Da haben wir dann poussiert mit den Mädchen, das war eine schöne Zeit."
Allgegenwärtiger Terror
Zu dieser Zeit war die Judenverfolgung bereits in vollem Gange. Hunderttausende pferchten die Deutschen in Ghettos, allein im Warschauer Ghetto drängten sich auf engstem Raum mehr als 350.000 Menschen. Morde an Juden waren an der Tagesordnung, ebenso Razzien und Geiselerschießungen. Der Terror war allgegenwärtig und prägte das Leben. Höhere Schulen wurden geschlossen, Zehntausende Männer, Frauen Kinder als Zwangsarbeiter verschickt.
Mehr und mehr kamen Wehrmacht und SS dem Ziel näher, das Hitler für den Feldzug ausgegeben hatte: die Auslöschung Polens, die "Beseitigung der lebendigen Kräfte". SS-Chef Heinrich Himmler verfolgte von Anfang an seinen Plan der "Vernichtung der polnischen Intelligenz": Zehntausende Ärzte, Professoren, Lehrer, Juristen ließ er verhaften und ermorden. Den Polen, die als "Untermenschen" galten, war in der neuen Welt der Nationalsozialisten nur noch ein Sklavendasein zugedacht.
"Da ich selber polnisches Blut in mir habe, habe ich keine Antipathie", sagt Pawlitzki. Stets habe er sich für das Land und die Literatur interessiert. Vielleicht liege das ja an seinem polnischen Urgroßvater. Dass er aber ausgerechnet als Besatzer in dessen frühere Heimat kam, war dem 18-Jährigen offenbar nicht bewusst. In seinem Tagebuch zu Beginn des Krieges vermerkte er: "Die Polen sind ganz ruhig und friedlich. Sie essen wenig und arbeiten schwer." Und er erwähnt einen polnischen älteren Fähnrich: "Er ist still und schweigsam und trägt sein Los mit zusammengebissenen Zähnen. Man sieht, dass er körperliche Arbeit ungewohnt ist. Er spricht etwas Deutsch … Ich brülle ihn nicht an, wie ich es mit den anderen tue."
Wenn er heute, 75 Jahre nach Kriegsbeginn, aus dem Tagebuch vorliest, stockt er immer wieder. Vielleicht nur, weil er seine Schrift schwer entziffern kann, vielleicht aber auch, weil er selbst ein wenig befremdet ist. Schließlich kam er aus einem liberalen Elternhaus, sein Vater saß als Sozialdemokrat zwei Mal in nationalsozialistischen Gefängnissen, unter anderem nach dem Hitler-Attentat 1944. "Da war ich so wütend, dass ich gewünscht habe, dass die Amis uns kaputtbomben."
Schon in den ersten Kriegswochen schrieb Pawlizki in sein Tagebuch: "Ich wünsche möglichst bald das Ende des Krieges herbei." Darauf musste er noch fast sechs Jahre warten. Jahre, über die er heute entschieden sagt: "Sie haben mich überhaupt nicht geprägt." Letztlich habe das Schicksal es mit ihm sehr gut gemeint. "Die schlimmen Sachen sind immer an mir vorbeigegangen." Wie er erzählt, war er nie direkt an der Front, wegen Tuberkulose wurde er schließlich sogar vom Wehrdienst freigestellt und studierte 1944 Jura in Posen. Schüsse habe er vor allem 1945 gehört, die schlimmste Zeit sei zum Ende des Krieges gewesen.
Da lag Polen längst in Trümmern. Millionen Menschen irrten durch das zerstörte Land; ihre einst so prächtige Hauptstadt Warschau war, wie von Hitler befohlen, dem Erdboden gleichgemacht. Sechs Millionen Polen, unter ihnen drei Millionen Juden, hatten die Deutschen umgebracht.
Quelle: ntv.de