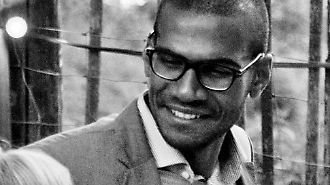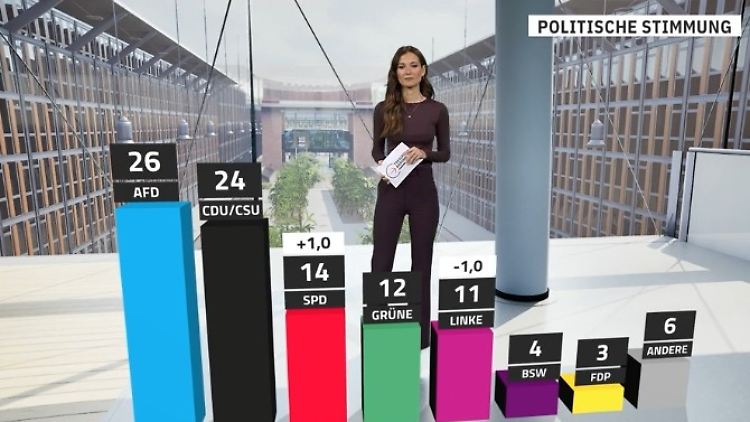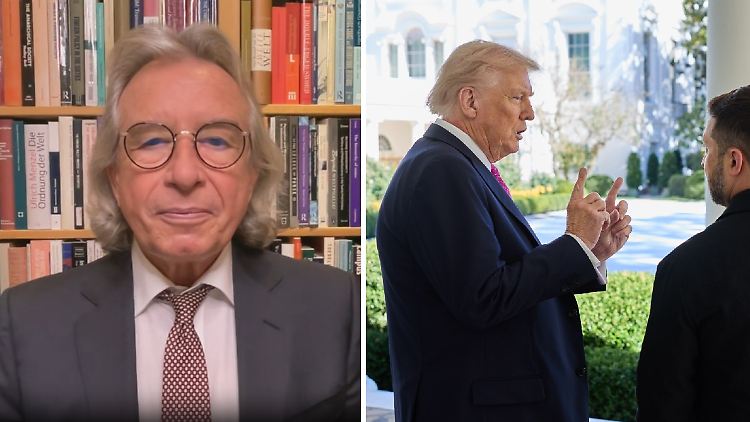Projekt Flüchtlingsquote scheitert EU feiert eine exklusive WG-Party
25.06.2015, 13:57 Uhr
Grenzübergang Saint Ludovic im Juni: Rund 200 Flüchtlinge wollten raus aus dem reichlich überforderten Italien und ihr Glück in anderen europäischen Staaten suchen. Die Behörden ließen sie nicht.
(Foto: REUTERS)
Die EU-Kommission will Flüchtlinge per Quote auf die Mitgliedsstaaten verteilen. Doch daraus wird nichts. Für einige Länder scheint jeder zusätzliche Flüchtling ein Flüchtling zu viel zu sein.
Es waren die Tage der ganz großen Worte. Nach dem Tod von Hunderten Flüchtlingen im Mittelmeer im April sagte Kanzlerin Angela Merkel Sätze wie: "Geld darf keine Rolle spielen." Manfred Weber, Fraktionschef der europäischen Volkspartei, verkündete: "Die Flüchtlinge sind nicht nur eine Aufgabe für wenige Mitgliedsstaaten, sondern eine Herausforderung für ganz Europa." Und Dimitris Avramopoulos, EU-Kommissar für Migration, fügte hinzu: "Verantwortung und Solidarität gibt es nicht in Häppchen, entweder tut man etwas oder man tut nichts." Avramopoulos versprach, dass die EU eine "helfende Hand" reichen werde.
Nur ein paar Wochen sind diese Tage der großen Worte her und schon ist klar: Angemessene Taten folgen ihnen nicht - wie so oft in der Flüchtlingspolitik. Auf dem EU-Gipfel heute Abend steht nicht nur die Eurokrise auf der Themenliste, sondern auch die europäische Migrationspolitik. Die Staats- und Regierungschefs werden einen vollkommen weichgespülten Beschluss zur gerechten Verteilung von Flüchtlingen in Europa fassen.
Die EU-Kommission wirbt seit den April-Katastrophen für den Einstieg in eine Quoten-Regelung. Jedes Land soll gemessen an seiner Bevölkerungsgröße, Wirtschaftsleistung, der Zahl bereits aufgenommener Flüchtlinge und seiner Arbeitslosenquote einen bestimmten Anteil der Flüchtlinge in Europa aufnehmen. Doch obwohl sich diese Regelung zunächst nur auf 40.000 Menschen beschränken soll, können sich die EU-Staaten nicht einmal auf dieses "Mindestmaß an Solidarität" (Avramopoulos) einigen. Mindestens ein Dutzend Staaten, darunter vor allem osteuropäische Länder, sagen Nein zu einer verpflichtenden Quote. Dabei geht es bei Ländern wie Tschechien oder der Slowakei nur um ein paar hundert Flüchtlinge mehr.
Im Entwurf der EU-Kommission kommt das Wort "verpflichtend" deshalb nicht vor. Die Staats- und Regierungschefs werden vereinbaren, die Flüchtlinge auf freiwilliger Basis zu verteilen. 2009 stieß die EU-Kommission schon einmal ein Pilotprojekt auf freiwilliger Basis an. Die EU sollte damals ihre Solidarität mit Malta beweisen. Doch sonderlich groß war diese Solidarität nicht. Die Bundesregierung erklärte sich bereit, 200 Flüchtlinge aus Malta aufzunehmen. Die grüne Europaabgeordnete Ska Keller sagt: "Mit Freiwilligkeit kommen wir nicht weiter."
Orbán droht mit dem Total-Boykott
Schon jetzt zeichnet sich ab, dass einige EU-Staaten bei einer freiwilligen Lösung überhaupt keine Flüchtlinge aufnehmen werden. Besonders deutlich machte das kürzlich Ungarns Ministerpräsident Victor Orbán. Das Zusammenwachsen der ungarischen Gesellschaft habe keine Chance, wenn "wir eine Art Wohnheim-Party" ankündigen, bei der jeder kommen und bleiben könne - und dann "bis in die Morgenstunden feiere", sagte er. Kurz vor dem EU-Gipfel drohte er gar mit einem Aussetzen des Dublin-III-Abkommens, der derzeitigen Grundlage der europäischen Flüchtlingspolitik. Danach müssen Flüchtlinge in dem EU-Land einen Asylantrag stellen, das sie als erstes betreten haben. Für Asylbewerber, die auf den östlichen Fluchtrouten über Land kommen, ist dieses Land oft Ungarn. Die Flüchtlingskatastrophe im April droht nicht mehr, sondern weniger Solidarität in der Gemeinschaft zu fördern.
Völlig tatenlos war die EU dennoch nicht. Sie entschloss bereits, militärisch gegen Schleuserbanden vorzugehen. Derzeit wirbt sie sogar für ein UN-Mandat, um auch an Land in Nordafrika eingreifen zu können. Und sie weitete die Grenzschutz-Programme Triton und Poseidon massiv aus. Bei den Patrouillenfahrten der zuständigen Agentur Frontex besteht die Möglichkeit, Flüchtlinge aus Seenot zu retten.
Anlass für übermäßigen Optimismus ist aber auch das nicht. Tage der großen Worte gab es schon nach der aufsehenerregenden Flüchtlingskatastrophe im Herbst 2013. Auch damals beschloss Europa einige vielversprechende Maßnahmen. Das italienische Seenotretttungsprogram "Mare Nostrum" entstand und rettete rund 150.000 Menschen das Leben. Ende 2014, als es saisonbedingt ruhig war auf dem Mittelmeer, lief das Programm aus.
Quelle: ntv.de