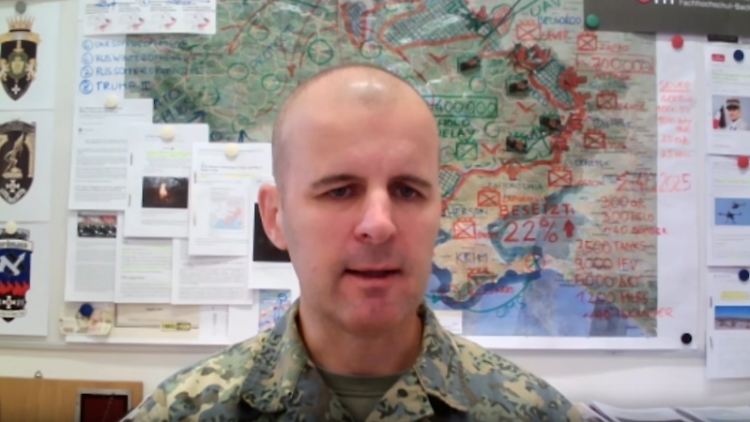Interview mit Carsten Linnemann "Wir müssen die Irrläuferpolitik beenden"
18.01.2017, 14:57 Uhr
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Carsten Linnemann ist Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU (MIT).
(Foto: dpa)
Der CDU-Abgeordnete Carsten Linnemann fordert, dass die Parteien wieder unterscheidbarer werden. Wenn er mit Wählern spreche, höre er immer häufiger: "Ist doch egal, welche Partei ich wähle, das ist doch alles die gleiche Soße."
n-tv.de: Sie haben ein Buch mit dem Titel "Die machen eh, was sie wollen" geschrieben. Kann es sein, dass Sie dabei an Ihre Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin gedacht haben?
Carsten Linnemann: Nein, überhaupt nicht. Diesen Satz gibt es seit Jahrzehnten, vermutlich schon, seit es Politik gibt. Eine gewisse kritische Distanz zur Politik gehört auch zu einer gesunden Demokratie dazu. Aber diese Distanz hat sich mittlerweile zu einer Verdrossenheit ausgewachsen, die sich nicht nur auf Politiker bezieht. Gewerkschaftsbosse, Journalisten, Wirtschaftsführer, selbst Kirchenvertreter haben einen ähnlichen Reputationsverlust erlebt.
Womit hat das angefangen?
Meiner Einschätzung nach mit der Eurokrise. Mit ihr kamen verstärkt Verteilungsfragen und Gerechtigkeitsfragen hoch, darunter Themen wie Rente und Manager-Boni. Das Fass zum Überlaufen brachte aber die Flüchtlingskrise. Auch da wurden nicht nur Politiker kritisiert, sondern auch Vertreter anderer Gruppen, die gesellschaftlich Verantwortung tragen. Sie alle transportierten ein Bild, das viele Menschen in ihrer Umgebung nicht mehr wiederfanden. Beispielsweise behaupteten einige Konzernchefs, dass man mit Flüchtlingen den zunehmenden Mangel an Fachkräften beheben könne. Das war offenkundig falsch.
Und führte zu einer Politikverdrossenheit?
Wohl eher zu einer Verdrossenheit über die etablierten Parteien. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und von einer allgemeinen Elitenverdrossenheit sprechen. Und die besorgt mich schon sehr. Denn es ist ein Entfremdungsprozess im Gange, der nicht nur unsere Parteienlandschaft zu zersplittern droht, sondern auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt schwächen könnte. Wir müssen uns daher alle fragen, wie wir diesen Entfremdungsprozess stoppen oder zumindest verkleinern können.
Was ist Ihr Vorschlag?
Für die Politik gibt es viele mögliche Antworten, aber besonders wichtig scheint mir die Unterscheidbarkeit der Parteien zu sein. Wenn ich mit Wählern, also mit ganz normalen Leuten bei mir im Wahlkreis oder anderswo in Deutschland spreche, höre ich immer häufiger: "Ist doch egal, welche Partei ich wähle, das ist doch alles die gleiche Soße." Gerade in der Euro- und in der Flüchtlingskrise hatten viele den Eindruck, dass alle Parteien im Bundestag mit einer Stimme sprechen. Da kann es auch nicht verwundern, wenn sich die Menschen von uns, von den etablierten Parteien abwenden. Wir müssen den Menschen wieder inhaltliche Unterschiede und echte Wahlmöglichkeiten bieten, ansonsten wählen sie gar nicht oder Protest.
Also die AfD.
Ja. Ich schätze, mehr als 80 Prozent wählen die AfD nicht wegen ihres Programms, sondern allein aus Protest. Das sollte ein Warnsignal an die Parteien sein, die im Deutschen Bundestag vertreten sind, auch an meine Partei. Ich will übrigens gar nicht mit dem Finger auf andere zeigen – ich sitze selbst im Bundestag, ich bin selbst betroffen.
Ein Punkt, mit dem Sie die CDU unterscheidbar machen wollen, ist die Soziale Marktwirtschaft. Aber mittlerweile beziehen sich sogar Linke positiv auf Ludwig Erhard und seinen Klassiker "Wohlstand für Alle". Ulrich Schneider, der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, hat sein neues Buch "Kein Wohlstand für alle!?" genannt. Darin beklagt er, dass die Reichen immer reicher und immer größere Teile der Mittelschicht abgehängt werden. Dies sei "Ergebnis einer Politik, die sich immer stärker einem modernen Neoliberalismus verpflichtet sieht".
In der Tat gibt es inzwischen Politiker quer durch alle Parteien, die sich auf Ludwig Erhard beziehen. Aber wenn man unser Wirtschaftssystem mit dem Begriff „neoliberal" beschimpft und gleichzeitig Ludwig Erhard beschwört, dann stimmt da was hinten und vorne nicht. Da versucht vielmehr jemand, Ludwig Erhard für seine Zwecke zu missbrauchen. Und die Schere zwischen Arm und Reich wird laut Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung eben nicht immer größer. Seit 2010 ist sogar eine gebremste oder rückläufige Lohnungleichheit zu beobachten.
Unser drängendstes Problem ist doch ein ganz anderes. In einer Allensbach-Untersuchung kam im vergangenen Jahr heraus, dass 60 Prozent sich Sorgen machen, ob sie ihren Lebensstandard im Alter halten können. Die Leute haben das Gefühl, dass es bisher immer aufwärts ging, jetzt aber nicht mehr. Zum Teil sind das gefühlte Ängste, zum Teil ist das real. Aber ob real oder nicht, die Politik muss solche Ängste aufgreifen. Und sie muss deutlich machen, wo dieses Land hinwill. Wir können beispielsweise nicht voraussetzen, dass alle begeistert sind, wenn sie das Stichwort "Digitalisierung" hören. Angestellte fragen sich, was das für ihren Arbeitsplatz bedeutet, auch für Mittelständler ist die Digitalisierung oft eine Herausforderung. Wenn man den Leuten solche Ängste nehmen will, dann muss man einen klaren Fahrplan entwerfen.
Hat die ökonomische Unsicherheit nicht auch damit zu tun, dass der Staat sich in den letzten Jahrzehnten immer stärker zurückgezogen hat, auch als Sozialstaat?
Das bezweifle ich. Mehr als 57 Prozent des Bundeshaushalts sind Sozialausgaben. Vor 15 Jahren waren das noch rund 35 Prozent. Deutschland gehört zu den Staaten mit dem höchsten Anteil der Sozialleistungen am Bruttosozialprodukt. Schauen Sie, die soziale Marktwirtschaft ist eine Medaille mit zwei Seiten: Es geht nicht nur um Solidarität, sondern auch um Eigenverantwortung. Das heißt, auf der einen Seite müssen die Menschen in die Lage versetzt werden, eigenverantwortlich zu handeln, auf der anderen Seite muss jenen geholfen wird, die das nicht können. Mir scheint, das Gleichgewicht zwischen diesen beiden Seiten ist verloren gegangen. Georg Fahrenschon, der Präsident des Deutschen Sparkassenverbands, hat mir in diesem Kontext kürzlich eine interessante Zahl genannt: 60 Prozent der Sparkassenkunden hätten am Ende des Monats kaum noch Geld für die private Vorsorge zur Verfügung. Angesichts aktueller Steuermehreinnahmen stellt sich doch die Frage: Wollen wir, dass der Staat diese Mehreinnahmen behält? Oder wollen wir das Geld den Bürgern zurückgeben, damit sie selbst entscheiden können, was sie damit anfangen?
Erika Steinbach, die gerade aus der CDU ausgetreten ist, sagte, es habe sie erschüttert, dass Merkel die Förderung der Elektromobilität gegen den Willen der Fraktion durchgesetzt habe. War das auch ein Verstoß gegen die Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft?
Das ist ein generelles Problem, keines, das mit einer Person zu tun hat. Selbst Wirtschaftsführer fordern in Sonntagsreden eine Ordnungspolitik à la Ludwig Erhard und setzen sich am Montag mit größter Vehemenz für die Einführung einer Kaufprämie für Elektroautos ein.
Sie kritisieren, dass die Volksparteien die wirklichen Probleme nicht mehr an der Wurzel packen. Haben Sie dafür ein Beispiel?
Etwa die Einführung der Rente mit 63. Die SPD wollte damals etwas für Dachdecker und Gerüstbauer tun. Jetzt gibt es die Rente mit 63, aber Dachdecker und Gerüstbauer nutzen sie kaum. Stattdessen haben wir mit dieser Maßnahme Fachkräfte aus dem Markt gezogen. Das ist ein klassisches Beispiel für eine Irrläuferpolitik, mit der wir aufhören müssen. Man tut so, als würde man Probleme lösen, aber in Wirklichkeit hat man sich um das eigentliche Problem gar nicht gekümmert – in diesem Fall die Erwerbsgeminderten. Die hätte man unterstützen müssen. Erst im Nachhinein hat man etwas für die gemacht.
Mit Carsten Linnemann sprach Hubertus Volmer
Quelle: ntv.de