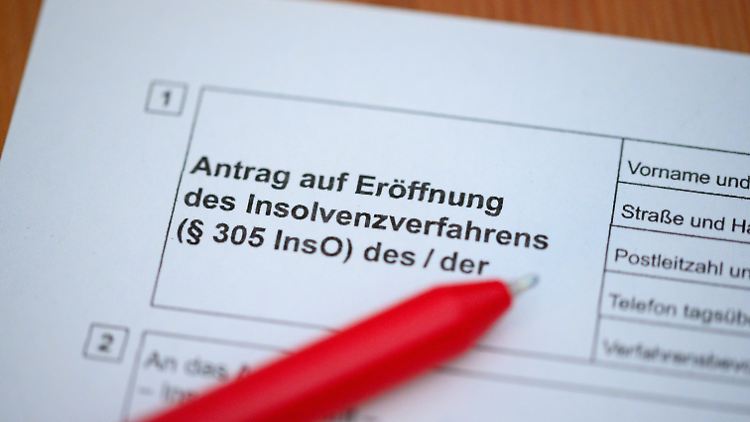Täuschen und tarnen Tricksen mit Verbrauchersiegeln
25.06.2008, 07:40 Uhr"Erster Platz", "im Test sehr gut", "umweltfreundlich", "fair gehandelt": Wer im Supermarkt Qualität, kontrolliert biologische Ware oder ethisch korrekte Produkte sucht, hat es mit einem ganzen Schilderwald von Prüfsiegeln zu tun.
Eine Auszeichnung sind sie alle - ob die Ware deswegen ausgezeichnet ist, bleibt Verbrauchern bei der Flut von Zeichen aber immer häufiger verborgen. Dass Unternehmen die Qualitätsmerkmale bisweilen missbräuchlich in ihrer Werbung verwenden, schafft zusätzliche Verwirrung.
Dabei können die Siegel verlässliche Lotsen im Warendschungel sein - wenn sich Verbraucher gründlich informieren und irreführende Werbung erkennen können. "Grundsätzlich muss man zunächst einmal unterscheiden: Es gibt Testergebnisse und Gütezeichen oder Labels", sagt Georg Abel, Geschäftsführer der Verbraucher Initiative. Tests nehme zum Beispiel die Stiftung Warentest vor. Seine Organisation hat auf der Homepage "label-online.de" etwa 300 Gütezeichen unter die Lupe genommen.
Zertifizierung
Um ein Qualitätszeichen auf der Ware oder in der Werbung verwenden zu dürfen, müssen Unternehmen sich zertifizieren lassen und bestimmte Vorgaben erfüllen. Die Prüfkriterien seien dabei ganz unterschiedlich: "Allein das Umweltzeichen 'Blauer Engel' gibt es für rund 80 unterschiedliche Produktgruppen mit verschiedenen Anforderungen - vom Gartenhäcksler über die Wechselkopfzahnbürste bis zum Umweltpapier", zählt Abel auf. Das könne auf die Schnelle kein Verbraucher nachvollziehen. "Die Labels sind ein schneller Rat für Verbraucher. Und das reicht den meisten ja auch - denn irgendwann macht jeder im Kopf zu."
Aber es gibt laut Abel auch Unterschiede bei der Verlässlichkeit: So stuft die Verbraucher Initiative längst nicht alle Gütesiegel als empfehlenswert ein. Der "Blaue Engel" für umweltfreundliche, abfallarme Produkte gehört zu denen, die bei den Verbraucherschützern gut wegkommen. Ebenso das internationale Siegel für fairen Handel "Fairtrade" oder das "Bio"-Siegel für Ware aus kontrolliert biologischem Anbau.
Irreführende Zeichen
Bei anderen sieht die Initiative allerdings Verwechslungspotenzial mit weiteren, ähnlichen Siegeln. Im schlimmsten Fall bewertet sie ein Zeichen als "irreführend", weil Verbrauchern die Arbeit der Prüfer unklar bleibe. Schnelle Orientierung bieten Zeichen aber auch dann nicht, wenn nicht deutlich wird, in welchen Abständen der Qualitätsnachweis erneuert werden muss. Das ist laut Abel von Fall zu Fall unterschiedlich. Der Experte rät Verbrauchern daher, auf der Homepage des werbenden Unternehmens die Prüfkriterien nachzuschlagen: "Man kann nicht alles kennen."
Das mühevolle Nachlesen können oder wollen wohl nur die wenigsten leisten. Das macht die Labels anfällig für Missbrauch: Denn was einmal klebt, werde nicht immer auch wieder entfernt, wenn die Zertifizierung erlischt. Dieses Problem ist auch bei Stiftung Warentest bekannt. Missbrauchsfälle dokumentiert allerdings der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), denn die Stiftung ist nach eigenen Angaben nicht zu Abmahnungen befugt. "Wir mahnen regelmäßig ab - im Schnitt etwa 90 Fälle im Jahr", sagt vzbv-Referentin Kerstin Hoppe.
Abmahnungen ausgesprochen
In diesem Jahr wurden bis Mitte Mai 38 Abmahnungen ausgesprochen. Da haben Unternehmen Testergebnisse auf nicht getestete Produkte oder andere Größen eines Produkts übertragen - die Größe könne aber entscheidend sein. Oder es wurde eine Ausstattungsvariante mit einem positiven Testurteil beworben, die gar nicht getestet wurde und laut Stiftung Warentest auch nicht übertragbar ist.
Immer wieder komme es auch vor, dass das Veröffentlichungsdatum fehlt. Für Verbraucher ist dann nicht nachvollziehbar, ob zum Beispiel ein "gut" immer noch gilt - oder ob der Test zum Beispiel aus dem Jahr 1995 stammt, erläutert Justiziar Winfried Ellerbrock von der Stiftung Warentest. Daher müsse in jedem Fall die entsprechende Ausgabe der Zeitschriften "test" oder "Finanztest" erwähnt werden. Um Missbrauch einzudämmen, hat die Organisation ihre Regeln kürzlich verschärft: Was bislang als "Empfehlung" für die Werbung formuliert war, ist jetzt ein Katalog von "Nutzungsbedingungen".
So dürfen zum Beispiel günstige Aussagen zu einem Produkt nicht allein beworben werden, wenn es auch ungünstige gibt. Und wenn sich ein wichtiges Merkmal eines Produkts oder einer Leistung seit dem letzten Test geändert hat, kann nicht einfach damit weiter geworben werden. Außerdem darf die Untersuchung nicht durch eine neuere überholt sein - erste Plätze im Sport werden schließlich auch immer wieder neu vergeben.
Quelle: ntv.de