Politik soll Abwanderung stoppenDeutsche Maschinenbauer haben "Wut im Bauch"
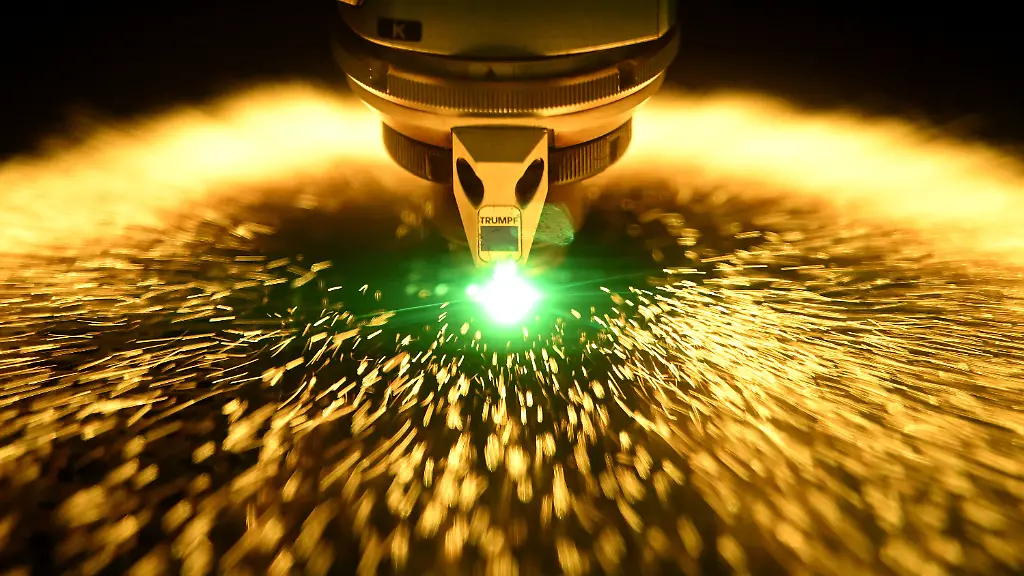
Die Politik höre und verstehe zwar die Warnungen aus der Wirtschaft, "trotzdem passiert am Ende nichts", klagt der Maschinenbauverband. Dabei sei die Deindustrialisierung eine valide Bedrohung. Die Stimmung in der Branche ist sogar schlechter als in der Pandemie.
Die deutschen Maschinenbauer warnen vor einer Abwanderung der Industrie aus der Bundesrepublik. "Noch sind wir nicht deindustrialisiert. Wenn wir nicht sofort gegensteuern, wird das aber passieren. Deindustrialisierung ist eine valide Bedrohung", sagte der neue Präsident des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Bertram Kawlath, der "Welt am Sonntag". "Wenn in Deutschland weiterhin so wenig investiert wird, beschleunigt sich der Abstieg, der gerade an immer mehr Stellen sichtbar wird."
Kawlath beklagte Regulierung, Bürokratie, hohe Kosten und eine untätige Politik. "Die Politik hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sehr viel Zeit vergeudet. Nun zeigt sich jeden Tag immer deutlicher, wie stark der Standort Deutschland dadurch zurückgefallen ist", sagte der VDMA-Chef.
Statt Standortfaktoren zu verbessern, sei das genaue Gegenteil passiert. Das sorge für schlechte Stimmung bei den Unternehmen und lasse die Wirtschaft abstürzen. "Aus diesem Tief müssen wir dringend heraus. Bei uns in der Branche herrscht große Ungeduld und Wut im Bauch, weil nichts vorangeht", sagte Kawlath weiter.
"Grundsätzlich Böses unterstellt"
In der Politik würde zwar die Warnung von Unternehmen und Wirtschaftsverbänden durchaus gehört und in der Sache oft auch verstanden, fuhr er fort. "Trotzdem passiert am Ende nichts." Meist scheitere die Veränderung von Standortfaktoren an parteipolitischen Querelen.
"Wir sehen aber auch ein riesiges Misstrauen gegenüber der Wirtschaft und daraus folgend ein Absicherungsbedürfnis. Uns wird von so manchen Politikern und NGOs grundsätzlich Böses unterstellt", sagte Kawlath weiter. Folge sei ausufernde Regulierung und Bürokratie.
Zur schwierigen Lage der deutschen Industrie sollen noch in diesem Monat nach Angaben von Bundeskanzler Olaf Scholz Gespräche mit Unternehmensvertretern, der Industrie, Gewerkschaften und Verbänden im Kanzleramt stattfinden. Die Ergebnisse werde er anschließend dem Bundestag zum Beschluss vorlegen, hatte Scholz am Mittwoch bei seiner Regierungserklärung angekündigt.
Branche pessimistisch wie nie
Der deutsche Maschinenbau schwächelt schon länger. Zwar legten die Bestellungen im August laut nun veröffentlichten Daten des Branchenverbandes zu. Allerdings sah VDMA-Konjunkturexperte Olaf Wortmann darin wegen eines extrem schwachen Vorjahreswertes lediglich einen "Ausreißer nach oben". Die Talsohle beim Auftragseingang sei noch nicht erreicht.
Wie aus einer Befragung der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PWC in der Branche hervorgeht, erwarten fast 60 Prozent der Entscheidungsträger auf Sicht von zwölf Monaten eine Konjunkturschwäche Deutschlands. Das sei ein Negativrekord aller bisherigen Erhebungswellen seit zehn Jahren. Der Anteil der Pessimisten sei in den letzten drei Monaten um mehr als 20 Prozentpunkte gestiegen.
"Vermutlich spielen globale Risiken wie Strafzölle, drohende Blockbildung und Krisenherde hier eine große Rolle", sagt PWC-Industrieexperte Bernd Jung. "Dass die Manager allerdings gegenwärtig finsterer auf die kommenden Monate blicken als zur Zeit der Corona-Pandemie, lässt sich mit der geopolitischen Großwetterlage allein kaum erklären." Vielmehr habe die Branche strukturelle Probleme. Dazu zählten eine Verteuerung von Standortfaktoren, der Produktionsrückgang sowie Innovationshemmnisse bei Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung.
Jung spricht von einer tiefer sitzenden Zukunftsangst, die auch Innovationen hemme. Gründe seien steigende Energie- und Personalkosten sowie das Regulierungsumfeld. Die Sorgen vieler Unternehmen gingen auch mit einer unterdurchschnittlichen Kapazitätsauslastung von lediglich 84,1 Prozent einher. Nur während der Lockdown-Phase in der Corona-Pandemie sei der Wert noch niedriger ausgefallen. Lediglich weniger als ein Drittel der befragten Unternehmen operiere noch nahe am Auslastungslimit.