Arbeitsmarkt im AusnahmezustandDeutsche arbeiten mehr, schaffen aber weniger
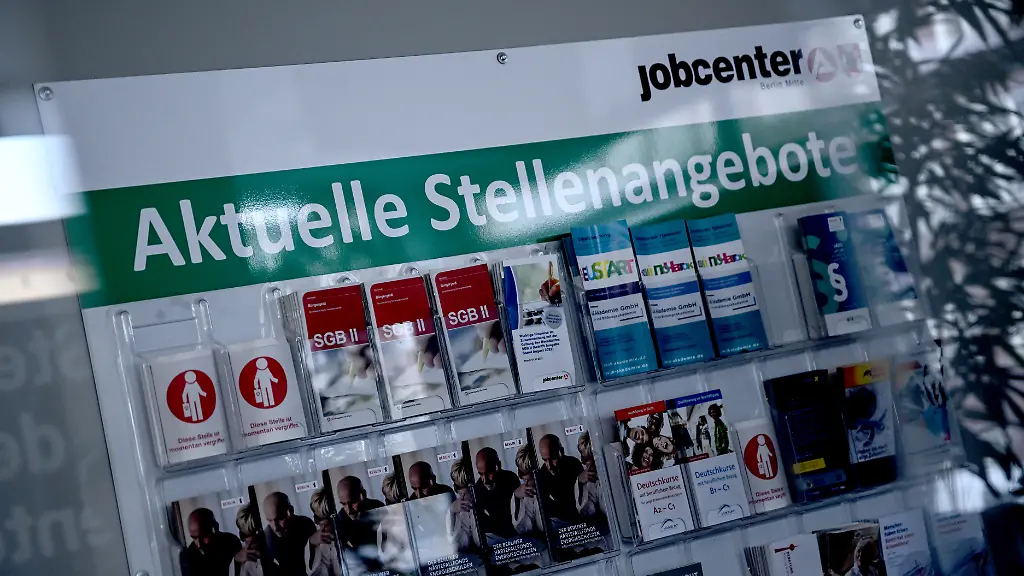
Die Konjunktur schwächelt, die Arbeitslosigkeit steigt. Trotzdem arbeiten in Deutschland mehr Beschäftigte, insgesamt mehr Stunden als je zuvor. Gleichzeitig klagen Unternehmen weiter über einen Mangel an Fachkräften. Lange kann dieser Zustand nicht anhalten.
Der deutsche Arbeitsmarkt befindet sich in einem historischen Ausnahmezustand. Erst zum zweiten Mal seit der Wiedervereinigung ist die sogenannte Stundenproduktivität gesunken. Der Wert beschreibt, wie viel in einer Volkswirtschaft pro geleisteter Arbeitsstunde erwirtschaftet wird. Historisch gesehen nimmt dieser Wert unter anderem dank der technologischen Entwicklung immer weiter zu. Ausnahmen gibt es in schweren Wirtschaftskrisen. Wie 2009, als die Wirtschaftsleistung gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) stark einbrach, Unternehmen die Arbeit aber nicht in gleichem Maße abbauten. 2023 war noch ungewöhnlicher: Das BIP sank um 0,3 Prozent, sowohl die Zahl der Beschäftigten als auch die der insgesamt geleisteten Arbeitsstunden in Deutschland stieg aber auf einen Rekordwert. Das heißt, in Deutschland wird mehr gearbeitet, aber weniger produziert.
Holger Schäfer, Ökonom und Arbeitsmarktexperte vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW), rechnet damit, dass dieser Trend im laufenden Jahr anhält, auch wenn die Wirtschaft wieder leicht wächst. "Das Arbeitsvolumen dürfte 2024 leicht stärker zulegen als das BIP." Das heißt, die Stundenproduktivität sinkt weiter. "Länger tragfähig ist dieser Ausnahmezustand allerdings nicht", sagt Schäfer im Gespräch mit ntv.de. "Spätestens 2025 wird sich das wieder ändern." Dann müssten die Unternehmen entweder wieder mehr produzieren und verkaufen - das heißt, das BIP wächst wieder deutlich. Oder aber sie müssten die Arbeit reduzieren, sprich Arbeitszeiten verkürzen, Überstunden herunterfahren oder Arbeitsplätze abbauen.
Die abnehmende Stundenproduktivität ist nur eines von mehreren widersprüchlichen Phänomenen, die derzeit auf dem Arbeitsmarkt zu beobachten sind. So klagen Arbeitnehmer gleichzeitig über die lahmende Konjunktur und über einen Fachkräftemangel. Das Arbeitsvolumen, also die Zahl aller geleisteten Arbeitsstunden, ist 2023 auf einen Rekordwert gestiegen und dürfte auch dieses Jahr weiterwachsen, während aber die durchschnittliche Arbeitszeit pro Erwerbstätigem sinkt. Gleichzeitig nimmt auch die Arbeitslosigkeit zu.
Kein Lösungsansatz für kommende Krise
Teilweise sind diese Phänomene mit der steigenden Zahl der Erwerbspersonen zu erklären, also der Menschen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Zuletzt waren das vor allem 2022 nach der russischen Invasion aus der Ukraine Geflüchtete, von denen viele im vergangenen Jahr in den deutschen Arbeitsmarkt eintraten. Auch derzeit wachsen die Bevölkerung und die Zahl der Erwerbspersonen weiter. Viele von ihnen finden angesichts der großen Nachfrage schnell Arbeit, ein Teil von ihnen bleibt allerdings auch - zumindest vorerst - arbeitslos. Auch dass bei sinkender durchschnittlicher Arbeitszeit insgesamt mehr Arbeit geleistet wird, lässt sich dadurch erklären, dass mehr Menschen auf dem Arbeitsmarkt sind. Dazu trägt einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) neben der Zuwanderung vor allem die steigende Zahl erwerbstätiger Frauen bei. Von diesen arbeitet allerdings fast die Hälfte in Teilzeit. Deswegen sinkt im Durchschnitt die Arbeitszeit pro Beschäftigtem.
Warum die Unternehmen in vielen Branchen trotz der schlechten wirtschaftlichen Lage - bei steigenden Löhnen und Gehältern - mehr Menschen einstellen und mehr arbeiten lassen, ist nicht so klar. Möglich sei, dass Unternehmen davon ausgingen, dass sich die gegenwärtig schwache Konjunktur bald aufhellt und deshalb auch in kriselnden Branchen kaum Arbeitsplätze abbauten, sagt IW-Experte Schäfer. Eine andere Möglichkeit sei, dass sie "Arbeitskraft horten", um sich auf die kommende demografische Krise auf dem Arbeitsmarkt vorzubereiten, wenn die geburtenstarken Jahrgänge von Mitte der 1960er-Jahre in Rente gehen.
Ab 2030 dürfte diese Krise ihren Höhepunkt erreichen. Dann werden jährlich Hunderttausende Menschen mehr in Rente gehen, als neue Jahrgänge in den Arbeitsmarkt eintreten. Wie diese Lücke geschlossen werden könnte, sei "noch nicht annähernd klar", so Schäfer. Kritisch sieht der Ökonom vom arbeitgebernahen IW in diesem Zusammenhang, insbesondere Forderungen nach einer Vier-Tage-Woche. Notwendig sei stattdessen eine Debatte darüber, wie mehr Arbeit attraktiver gemacht werden könne, etwa durch die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.