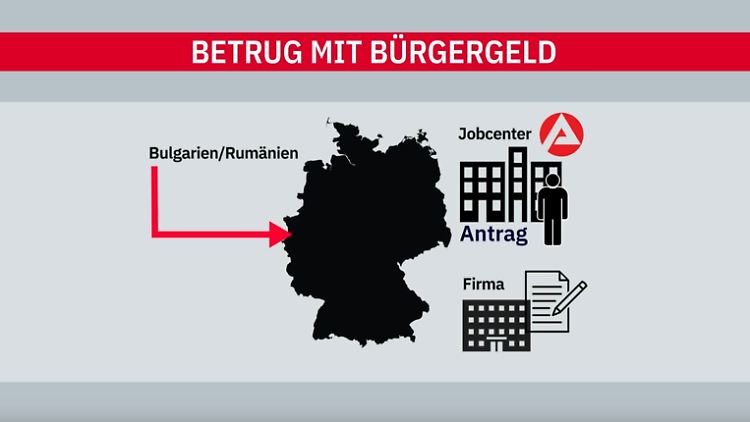Wie viel Rüstung braucht Europa? Die Sprengkraft der EADS-Pläne
10.12.2013, 16:58 Uhr
Europäisches Vorzeigeprojekt mit mangelndem Exporterfolg: Der Eurofighter "Typhoon".
(Foto: REUTERS)
Der Steuerzahler atmet auf. Die Neuausrichtung bei EADS ist konsequent – und mehr als nur ein kleiner Kurswechsel. Die Entscheidung schwächt die europäische Rüstungsindustrie. Kann sich Deutschland das wirklich leisten?
Der Konzernumbau bei EADS zeigt vor allem eines: Die europäische Rüstungsindustrie befindet sich im Umbruch, die gesamte Branche muss sich neu aufstellen. Mit dem aktuellen Stellenabbau in der Verteidigungssparte Cassidian erzwingt EADS-Chef Tom Enders eine Debatte, vor der sich auch Deutschland lange gedrückt hat. Im Kern lautet die Frage: Braucht Europa eine starke Rüstungsindustrie?
Die Zeiten satter Verteidigungsetats sind vorbei. Der Spardruck in den Staatshaushalten lässt die Budgets für militärische Großprojekte schrumpfen. Gewichtige Neuanschaffungen wie etwa der neue Militärtransporter A400M, der Kampfhubschrauber "Tiger" oder der Transporthubschrauber NH90 werden gekürzt, umständlich nachverhandelt oder bei einzelnen Kunden gleich komplett auf Eis gelegt.
Waffenschmiede im Hinterhaus
Schon jetzt produziert EADS einen Großteil seiner militärischen Produktlinien nahezu ausschließlich für europäische Kunden. Größere Exporterfolge kann Cassidian, die Verteidigungssparte des multinationalen Europakonzerns, selten verbuchen. Beinahe egal ist dabei, ob das im Einzelfall an den im Vergleich zu den USA, Russland oder China strikten Beschränkungen im Rüstungsexportgeschäft liegt oder an der auf europäischer Ebene eher schwach ausgeprägten politischen Unterstützung. Nur zur Erinnerung: Wenn es um den Verkauf französischer Militärmaschinen geht, reist Frankreichs Staatspräsident persönlich bis nach Indien. EADS bekommt solche Hilfe nicht.
Die Anzahl der möglichen Kunden ist im hochspezialisierten Segment der Kampfjets recht übersichtlich. Selbst finanzstarke Staaten wie Oman oder Katar schaffen sich Jagdflugzeuge nicht leichtfertig an. Eine solche Entscheidung kann eine Luftwaffe auf Jahrzehnte an das gewählte System binden. Eine wichtige Rolle spielen Bündnisbeziehungen und nationalstaatliche Interessen. Mit dem Eurofighter "Typhoon" zum Beispiel tritt EADS regelmäßig nicht nur gegen die starke Konkurrenz aus den USA und Russland an, sondern auch gegen innereuropäische Wettbewerber wie etwa den Saab "Gripen" aus Schweden und die Dassault "Rafale" aus Frankreich.
Was kann sich EADS leisten?
Die ausbleibenden Exporterfolge wie zuletzt in Indien, der Schweiz, Saudi-Arabien und Südkorea haben Folgen. Der Eurofighter kommt am Markt nicht an. Besonders schmerzhaft sind solche Rückschläge vor allem angesichts der jahrzehntelangen Entwicklungszeit und den entsprechend hohen Vorleistungen. Bei den übrigen langfristig angelegten Rüstungsgroßprojekten sieht es nicht viel anders aus: Die Nachfrage passt schon lange nicht mehr zum Angebot. Wie lange kann EADS die erforderlichen Entwicklungs- und Produktionskapazitäten im Rüstungsbereich vorhalten? Und: Warum sollte sich ein privatwirtschaftlich organisierter Konzern mit Börsennotierung einen solchen Luxus leisten?

"Typhoon"-Fertigung im Manchinger Cassidian-Werk: Ein Kampfjet ist kein Selbstzweck.
(Foto: REUTERS)
Aus der Sicht des europäischen Steuerzahlers kann es darauf nur eine Antwort geben: Enders Stellenabbau bei Cassidian ist nicht nur konsequent, sondern auch richtig. Europa kann sich nicht mit zusätzlichen Kampfflugzeugen ausstatten, nur um Hightech-Arbeitsplätze in der Provinz zu erhalten. Für Cassidian gibt es keinen anderen Ausweg. Selbst der Einstieg in ein eigenes europäisches Drohnenprojekt dürfte Experten zufolge wohl kaum ausreichen, um die Rüstungsbetriebe in Manching und anderen deutschen EADS-Standorten in vollem Umfang zu erhalten.
Politisch brisanter Stellenabbau
Allerdings müsste dieser Gedanke auch zu Ende gedacht werden: Die Neuausrichtung von EADS läuft entweder auf einen verstärkten Rüstungsexport in die sogenannten Drittstaaten außerhalb der Nato hinaus – oder auf einen umfassenden Kompetenzverlust im militärischen Flugzeugbau und der gesamten, daran anknüpfenden Rüstungstechnologie.
Kann der Steuerzahler, kann die Berliner Politik, das wirklich wollen? Auf lange Sicht macht sich Europa damit abhängig von der Waffentechnologie externer Anbieter, in diesem Fall aller Voraussicht nach von den Produkten der ohnehin schon überaus einflussreichen US-amerikanischen Rüstungsindustrie. Dort dürften die Vertreter der Branche bereits feiern.
Wenn die Europäer keine andere Antwort für die Nöte ihrer militärischen Hochtechnologieunternehmen finden, dann könnten bald Konzerne wie Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman oder Boeing den künftigen Kunden in Europa womöglich nicht nur die Preise diktieren, sondern zugleich auch vorgeben, welche Waffensysteme von wem, wo und in welchem Umfang zum Einsatz gebracht werden können. Anschaffungsdebakel wie das rund um das Drohnenprojekt "Eurohawk" dürften sich wiederholen. Schließlich scheiterte die entscheidende Zulassungsfrage dort nicht etwa an unfähigen Beamten, sondern an der Weigerung des US-Herstellers, die hochgeheime US-Steuerungstechnologie für die europäische Luftfahrtaufsicht offenzulegen.
"Eurohawk" als Warnung
Der Fall "EADS" führt also mitten hinein in eine hochpolitische Richtungsfrage: Wer die militärische Eigenständigkeit als eine der Grundlagen für eine eigenständige Außenpolitik versteht, der kann diese Entwicklung nicht gutheißen – und wird ihr sicher nicht sehenden Auges entgegengehen, ohne doch noch nach einem Weg zu suchen, wie das militärtechnische Knowhow in Europa erhalten bleiben kann.
Schließlich unternehmen die Europäer auch auf anderen Gebieten der Hochtechnologie enorme Anstrengungen, um technologisch mit den Vereinigten Staaten und den aufstrebenden Großmächten auf Augenhöhe oder zumindest weitgehend unabhängig zu bleiben. Projekte wie das satellitengestützte Navigationssystem Galileo – konzipiert als eigenständige und unabhängige Alternative zum US-dominierten GPS-System – belegen, wie ernst es den politischen Entscheidern damit bislang war.
Dort gehen Projektkosten schon jetzt weit in den zweistelligen Milliardenbereich. Wenn sich Europa ohnehin komplett in den technologischen Windschatten der Amerikaner stellen wollte, dann hätte sich wohl auch für diese Ausgaben eine andere Verwendung finden lassen.
Quelle: ntv.de