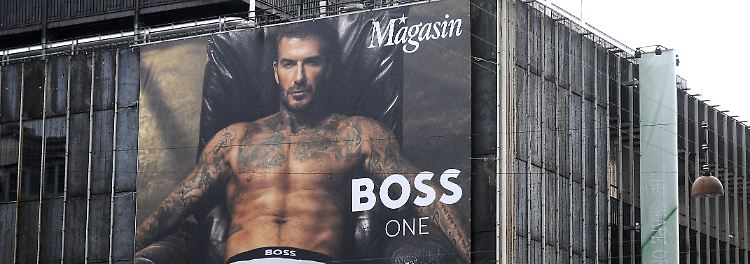Zu Hause im Berliner "Miljöh" 150 Jahre Heinrich Zille
10.01.2008, 09:58 UhrHeinrich Zille ist auch 150 Jahre nach seiner Geburt am 10. Januar 1858 einer der populärsten Berliner Künstler. "Pinselheinrich" oder "Papa Zille", wie ihn die Straßenkinder, Kleinganoven, Pennbrüder, Kneipenwirte oder Huren von Berlin liebevoll nannten, war ein Mann, der das "Armeleute-Milieu" aufgrund seiner eigenen Herkunft kannte. Er hat den armen Leuten aus seinem "Milljöh" später mit seinen ebenso bissig-humoristischen wie kritischen Zeichnungen wenigstens etwas Lebensmut machen und auch Selbstbehauptungswillen geben können, oft auch mit einer Prise Galgenhumor. Für Kurt Tucholsky hat der volkstümliche Zille "die reinste Inkarnation Berlins verkörpert" ("Du kennst den janzen Kleista - den ihr Schicksal: Stirb oda friß! Du warst ein jroßa Meista. Du hast jesacht, wies is").
Zille hat dem "Lumpenproletariat" ein zeitkritisches Denkmal gesetzt und dabei den dunklen Norden und Osten der Reichshauptstadt dem glänzenden und prahlenden Westen Berlins gegenübergestellt. "Meine erste eigene Wohnung war im Osten Berlins im Keller", erinnerte sich Zille, der später in das "vornehmere" Charlottenburg zog, "nun sitze ich schon im Berliner Westen, vier Treppen hoch, bin also auch gestiegen".
Ohne Berührungsängste
Zille streifte zeichnend durch alle möglichen Winkel der rasant wachsenden Industriemetropole Berlin zur Jahrhundertwende mit all ihren Schattenseiten - den Mietskasernen, nassen Kellerwohnungen und dunklen Hinterhöfen. Und er sprach die Sprache der kleinen Leute ohne Berührungsängste. "Jede Kneipe und Destille kennt den guten Vater Zille" wurde zum geflügelten Berliner Spruch in jenen Proletariervierteln. "Das glaubt ja keiner, was ich alles gesehen habe", wird Zille später einmal sagen.
"Es tut weh, wenn man den Ernst als Witz verkaufen muss", resümierte der Zeichner, der sich auch lange einem Streit in Künstlerkreisen ausgesetzt sah, ob er nun ein Künstler ist oder nur ein Witzblattzeichner. "Als Künstler hat er das Gewissen einer gleichgültigen Gesellschaft aufgerüttelt, und noch im Elend vermochte er zu lächeln", meinte Zilles Urenkel Hein-Jörg Preetz-Zille im Vorwort zu einer Ausstellung im Berliner Zille-Museum, das sich seit geraumer Zeit erfolgreich um eine Zille-Renaissance bemüht.
"Rinnsteinkunst" und "Abortzeichner" waren die Vokabeln, mit denen der Kaiser und sein Hofstaat solche Kunst und Künstler (wie auch Max Liebermann oder Käthe Kollwitz) titulierten. "Der Kerl nimmt einem ja die janze Lebensfreude", meinten sie. Und seine Zeichnungen der Straßenfrauen oder Badenden mit ausladenden Hinterteilen brachten Zille sogar in den Pornografie-Verdacht. Dafür wurde Zille - eine besondere Auszeichnung in der ansonsten eher ruppigen Metropole - ein Berliner Original, so wie auch die Sängerin Claire Waldoff mit ihrer "Berliner Schnauze": "Det war sein Milljöh", hieß eines ihrer Zille und seinen "Kindern" gewidmeten Lieder. Zille brachte auch mit seinen Bildunterschriften den Berliner Mutterwitz quasi mit ins Bild mit Hinterhof-Sprüchen wie "Mutter, jib doch mal die zwee Blumentöppe raus, Lieschen sitzt so jerne ins Jrüne!"
"Kinder der Straße"
"Es ist an der Zeit, den sozialen Kern seiner Arbeit und die Empathie des Künstlers für die Verlierer der Industriegesellschaft wieder freizulegen, ohne die humoristische Seite dieses Werks außer Acht zu lassen", betonen die Veranstalter einer Doppelausstellung über Zille anlässlich seines 150. Geburtstages mit dem Titel seines ersten Buches, "Kinder der Straße". Sie ist vom 11. Januar an in der Akademie der Künste am Pariser Platz und im Ephraim-Palais im Nikolaiviertel zu sehen. Sie führt erstmals die verschiedenen künstlerischen Bereiche zusammen, mit denen der "Sozialkomiker" und Bildchronist Zille arbeitete - auch als Fotograf, der in seinem Milljöh mit seinem breitkrempigen Hut und langem Vollbart ("Professorchen mit der Nickelbrille") umherstreifte und eine reiche Sammlung an historischen Fotografien des Berliner Alltags jener Jahre vor rund 100 Jahren hinterlassen hat.
Rudolf Heinrich Zille, der erst später dem väterlichen Namen Zill ein e hinzusetzte, wurde am 10. Januar 1858 in ärmlichen Verhältnissen in Radeburg bei Dresden geboren. Er übersiedelte als Neunjähriger mit seinen Eltern nach Berlin - in eine muffige Wohnung in der Nähe des Schlesischen Bahnhofs (heute Ostbahnhof), das Essen wurde aus der Volksküche geholt. Gegen den Willen seiner Eltern begann Zille eine Ausbildung als Lithograph und studierte als Abendschüler an der Königlichen Kunstschule.
"Hurengespräche" und "Berliner Luft"
Zilles spätere Popularität begann durch seine Mitarbeit an der satirischen Zeitschrift "Simplicissimus" und den "Lustigen Blättern" nach der Jahrhundertwende. 1913 erscheinen seine Bildbände "Mein Milljöh" sowie die Zyklen "Hurengespräche" und "Berliner Luft". Bald war Zille auch in Kunstausstellungen vertreten, aber erst 1921 erwarb auch die Nationalgalerie in Berlin Zeichnungen von ihm. 1924 wird Zille auf Vorschlag von Max Liebermann in die Preußische Akademie der Künste aufgenommen. Am 9. August 1929 stirbt der Maler und erhält als 80. Berliner Ehrenbürger ein Ehrengrab in Stahnsdorf bei Berlin.
Schon zu seinen Lebzeiten setzte eine Art verklärende "Zille-Nostalgie" ein, mit der sich die sogenannten guten Bürger mit "Hofbällen im Zille-Stil" als Wohlfahrtsveranstaltungen schmückten. Später werden sich Restaurants und Kneipen auch "Zille-Stuben" nennen. Im Frühjahr 2007 wurde das Zille-Museum im Berliner Nikolaiviertel, das wegen Finanznot vorübergehend hatte schließen müssen, wiedereröffnet. Über eine der umfangreichsten Zille- Sammlungen in Deutschland verfügt das Wilhelm-Busch-Museum in Hannover. Zum 150. Geburtstag Zilles erscheint am 2. Januar auch eine 55-Cent-Sonderbriefmarke der Deutschen Post mit dem Motiv "Gesellschaft in einer Altberliner Destille".
Von Wilfried Mommert, dpa
Quelle: ntv.de